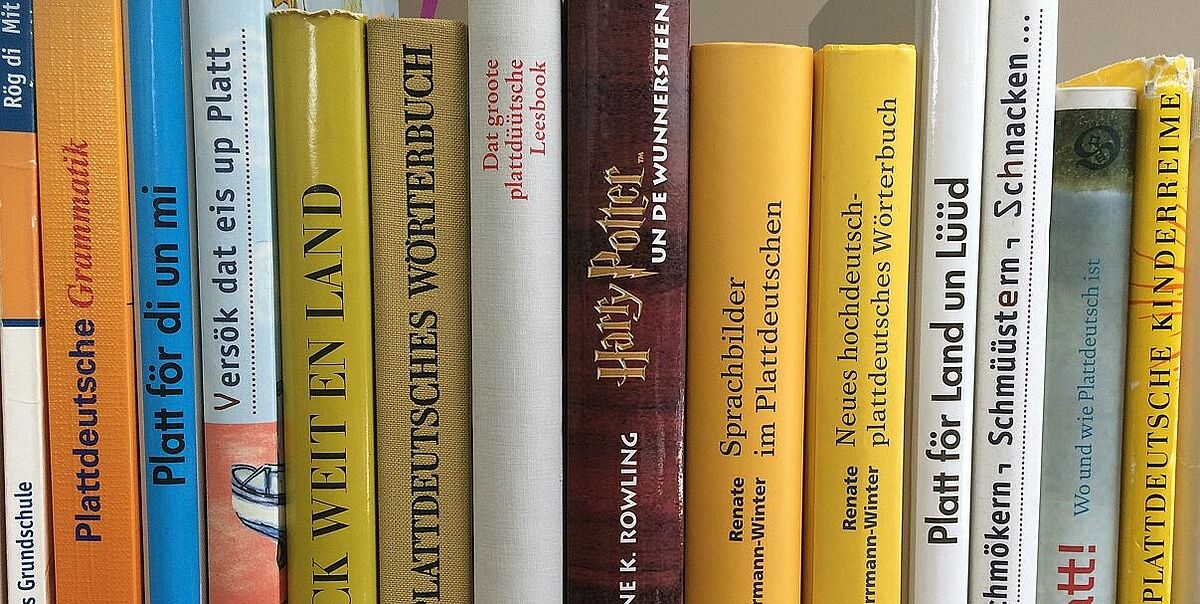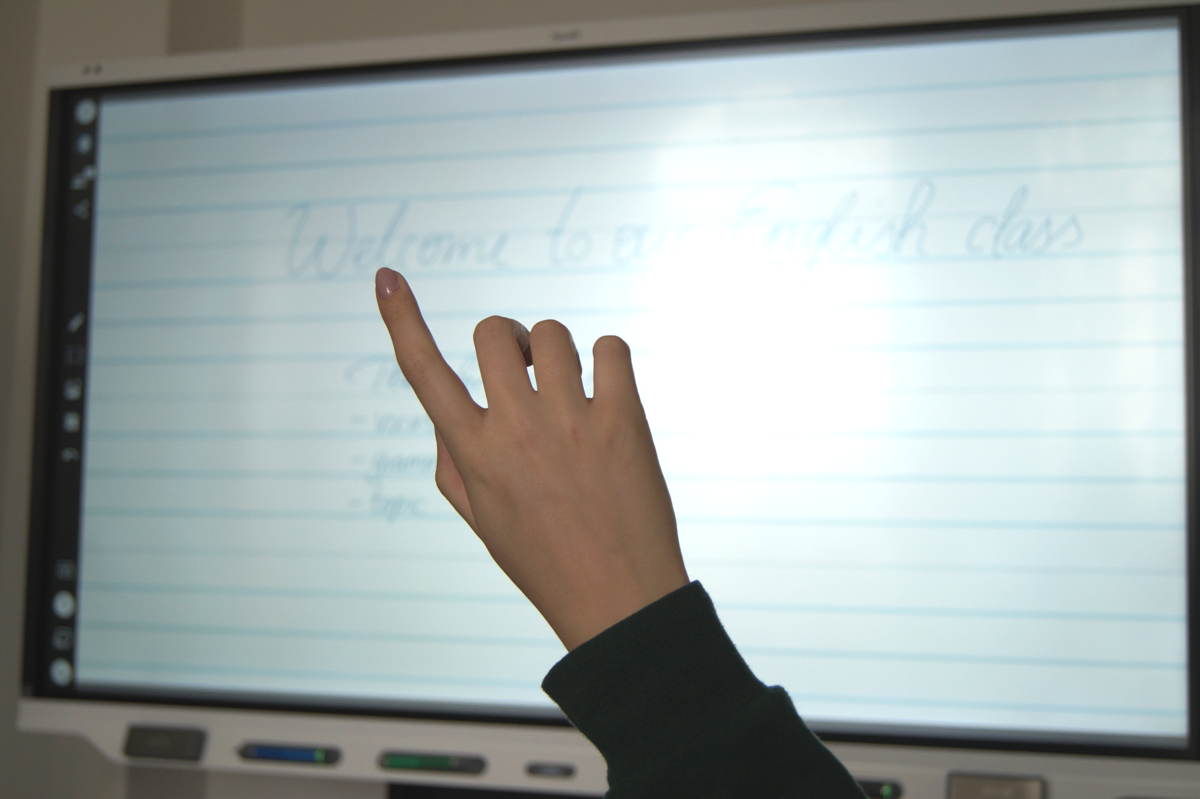Einrichtungen am Institut für Deutsche Philologie
Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik
Das Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik (KND) hat die Aufgabe, die Lehrerausbildung im Bereich Niederdeutsch zu stärken und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus forschen wir in den Bereichen kooperatives Lernen und digitale Bildung und entwickeln didaktische Materialien. Das KND unterbreitet berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungsangebote für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Lehrerinnen und Lehrer.
Mit dem Aufbau des Kompetenzzentrums festigt das Land Mecklenburg-Vorpommern die universitäre Ausbildung im Bereich Niederdeutsch und den angrenzenden Themenfeldern und kommt damit nicht nur den Verpflichtungen nach, die ihm aus der „Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“ erwachsen, sondern auch einem steigenden Bedürfnis in der Bevölkerung, die niederdeutsche Sprache als Teil der norddeutschen Identität wieder in das Bewusstsein zu rücken und zu erhalten.
Lektorat Deutsch als Fremdsprache
Das Lektorat Deutsch als Fremdsprache führt seit 1991 erfolgreich Sprachkurse zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium in Deutschland durch. Wir sind eine bei der Hochschulrektorenkonferenz und dem Fachverband DaF akkreditierte Einrichtung, deren Zertifikat an allen Hochschulen Deutschlands anerkannt ist. Wir bereiten unsere Kursteilnehmer*innen in kleineren, multikulturellen Sprachgruppen (max. 20 Studierende) auf ein Studium in Deutschland vor, indem sie bei uns Grammatik, Wortschatz, mündliche und schriftliche Kommunikation über wissenschaftliche und aktuelle Themen sowie wissenschaftliche Arbeitsweisen für das Studium lernen.
Zur Vorbereitung auf die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) bieten wir Kurse auf dem Niveau der Mittelstufe (1. Semester, B2) und Oberstufe (2. Semester, C1) mit täglich fünf Stunden Deutschunterricht an. Außerdem haben die Teilnehmer*innen der DSH-Kurse die Möglichkeit, Konversationskurse und Phonetikkurse, die speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden aus unterschiedlichen Sprachräumen abgestimmt sind, zu besuchen.
Zudem können die Teilnehmer*innen der DSH-Kurse schon während des Sprachkurses erste Kontakte zu Ihrem zukünftigen Institut an der Universität Greifswald knüpfen.
Wolfgang-Koeppen-Archiv
Das Wolfgang-Koeppen-Archiv (WKA) verwahrt den Nachlass des Schriftstellers Wolfgang Koeppen (1906 bis 1996), darunter Typoskripte, persönliche Dokumente, Briefe, Bilder und die private Bibliothek. Zum Œuvre des Essayisten, Romanciers und Reiseschriftstellers gehören neben den veröffentlichten Texten zahlreiche Skizzen, Varianten und Fragmente, die den Blick auf Koeppens literarische Werkstatt freigeben.
Vorrangige Aufgabe des Archivs ist die Förderung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Leben, Werk und Rezeption Wolfgang Koeppens. Das Wolfgang-Koeppen Archiv unterstützt nationale wie auch internationale Forschungsvorhaben sowie Ausstellungsprojekte und begleitet die Neuausgabe der "Werke in 16 Bänden" im Suhrkamp Verlag.
Für die Forschung vor Ort stehen ein Arbeitsplatz und eine kleine Präsenzbibliothek zur Verfügung. Führungen durch die aktuelle Ausstellung im "Münchner Zimmer“ und die Besichtigung der Bibliothek Koeppens sind nach Absprache möglich.
Pommersches Wörterbuch
Die wechselvolle Geschichte des Pommerschen Wörterbuchs, das seit 1999 wieder an der Universität Greifswald beheimatet ist, reicht bis weit in das 20. Jahrhundert zurück und erzählt von Höhen und Tiefen, Verlusten und Neuanfängen.
Das bereits 1925 durch Wolfgang Stammler in Greifswald gegründete großlandschaftliche Wörterbuch widmet sich der Erfassung und Dokumentation des Wortschatzes der niederdeutschen (plattdeutschen) Mundarten Pommerns und füllt damit einen letzten weißen Fleck aus auf der Landkarte der Dialektwörterbücher, die den deutschen Sprachraum heute nahezu flächendeckend erfassen.
Den ersten großen Einschnitt für das Vorhaben markierte der Zweite Weltkrieg, der zum Verlust fast des gesamten bis dahin gesammelten Materials führte. So ging etwa die Masse der 1945 nach Lübeck ausgelagerten Archivbestände verloren. Nur zufällig konnten wenigstens noch einige von den Archivzetteln gerettet werden, die sich in der Privatwohnung des zeitweiligen Leiters Kurt Mischke in der Nähe von Greifswald befanden und dort in der Nachkriegszeit zunächst als willkommenes Schreibpapier für die dörfliche Bevölkerung und die Schulkinder genutzt wurden.
Ein Neuanfang war also unausweichlich und wurde ab 1947 unter der Leitung von Hans Friedrich Rosenfeld engagiert vorangetrieben. Fragebogen wurden versandt, zahllose Mundartsprecher interviewt, Tonbandaufnahmen getätigt. Diese Anstrengungen ließen das Archiv rasch anwachsen, das gegen Ende der sechziger Jahre trotz der Schwierigkeiten bei der Suche nach Gewährsleuten aus dem ehemaligen Hinterpommern schließlich die eindrucksvolle Zahl von ca. 1,2 Millionen Belegzetteln erreichte. Diese Belegzettel sind die wichtigste Grundlage für die Erarbeitung der insgesamt etwa 60.000 Wortartikel für das PWB.