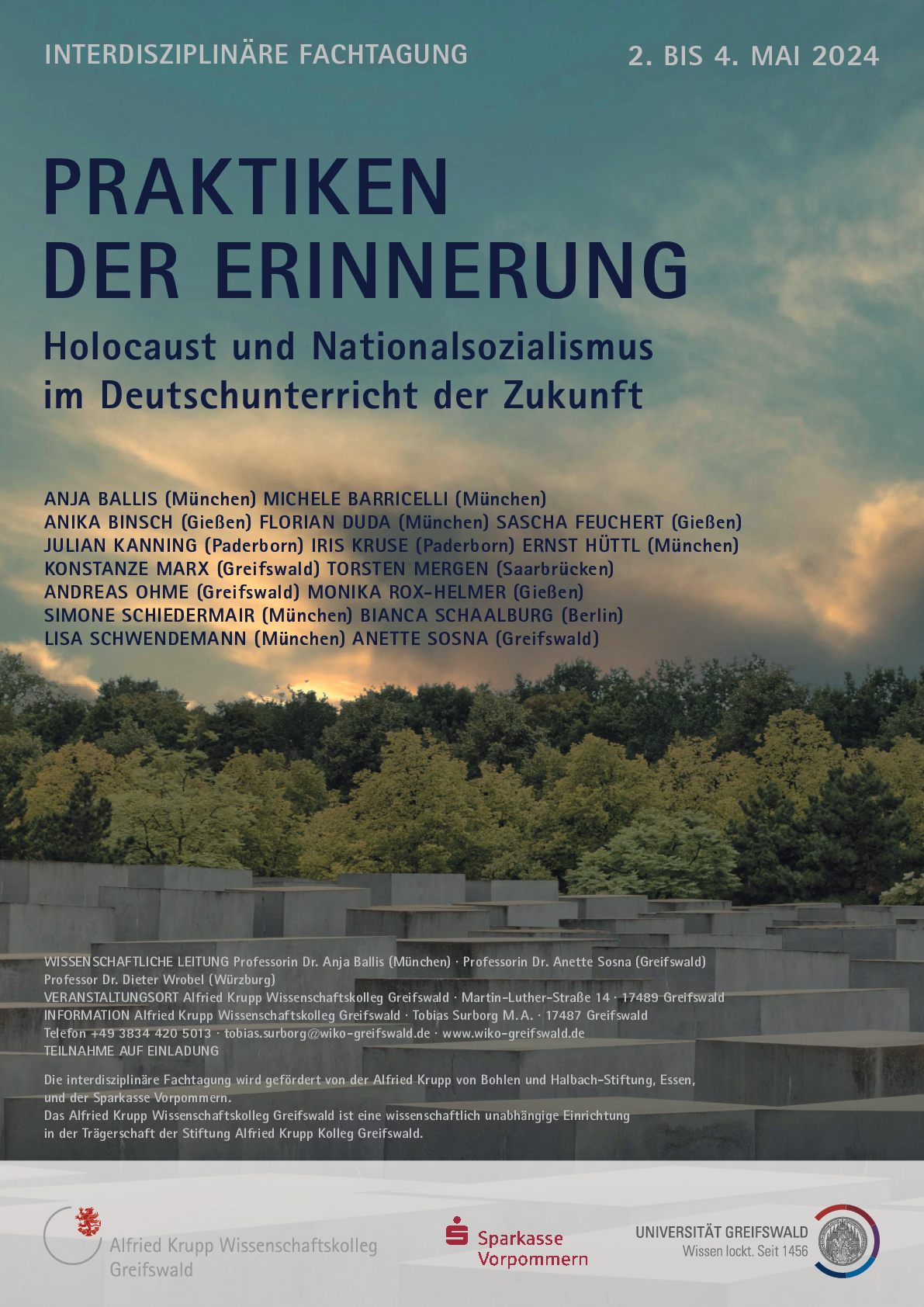Didaktik der deutschen Sprache und Literatur

Der Lehrstuhl „Didaktik der deutschen Sprache und Literatur“ befasst sich mit Lehr- und Lernprozessen in den Bereichen Literatur-, Sprach- und Mediendidaktik des Deutschen. Wir qualifizieren angehende Deutschlehrkräfte für die weitere Ausbildung an Grundschulen, Regionalen Schulen und Gymnasien.
Die Forschungsschwerpunkte der Professur liegen in den Bereichen Literarisches Lernen, Interpretieren literarischer Texte, Literatur und Bildung sowie (Kinder- und Jugend-)Literatur zu Holocaust und Nationalsozialismus.
Unser zentrales Anliegen für das Lehramtsstudium ist eine effektive Verbindung von Theorie und Praxis. Die Vermittlung fundierter theoretischer Kenntnisse der Deutschdidaktik auf dem aktuellen Stand der Forschung gehört dazu ebenso wie eine reflexive und unterstützende Begleitung von Praxisphasen.
Kontakt
Prof. Dr. Anette Sosna
Lehrstuhlinhaberin
Rubenowstraße 3 - Raum 3.10
17487 Greifswald
Tel.: +49 3834 420 3410
anette.sosnauni-greifswaldde
Henrike Lehmann
Sekretariat
Rubenowstraße 3 - Raum 2.19
17489 Greifswald
Tel.: +49 3834 420 3412
fachdidaktik-deutschuni-greifswaldde
Sprechzeiten:
Montag 8:00-12:00 Uhr + 12:30-15:30 Uhr
Dienstag 08:00-12:00 Uhr + 12:30-14:30 Uhr
Mittwoch 08:00-12:00 Uhr
Freitag 11:00-14:00 Uhr
Aktuelles
Bild-Text-Lesung zur Graphic Novel von Bianca Schaalburg „Der Duft der Kiefern. Meine Familie und ihre Geheimnisse“ und darauffolgende Podiumsdiskussion
Öffentlicher Teil der Fachtagung „Praktiken der Erinnerung – Holocaust und Nationalsozialismus im Deutschunterricht der Zukunft“
Der Vortrag findet als öffentliche Abendveranstaltung innerhalb der interdisziplinären Fachtagung „Praktiken der Erinnerung – Holocaust und Nationalsozialismus im Deutschunterricht der Zukunft“ statt.
Freitag, 3. Mai 2024
18.00 Uhr im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald, Martin-Luther-Straße 14, Greifswald
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Flyer sowie der Tagungswebsite: https://www.wiko-greifswald.de/praktiken-der-erinnerung/oeffentliche-lesung/.
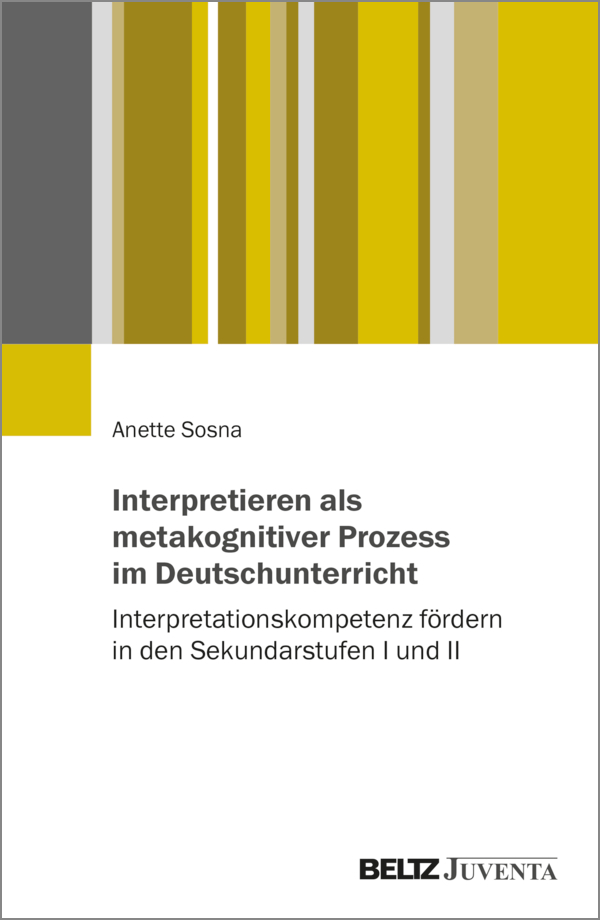
Interpretieren als metakognitiver Prozess im Deutschunterricht
Sosna, Anette: Interpretieren als metakognitiver Prozess im Deutschunterricht. Interpretationskompetenz fördern in den Sekundarstufen I und II
Beltz Juventa: Weinheim 2023
ISBN 978-3-7799-6891-7
Erscheinungsdatum: 21.06.2023
Habilitationsschrift zur Feststellung der Lehrbefähigung im Fach Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg
Inhalt:
Das Interpretieren literarischer Texte gehört zu den grund-legenden Kompetenzen, die im Deutschunterricht weiter-führender Schularten vermittelt werden, erweist sich aber aus fachwissenschaftlicher wie auch aus fachdidaktischer Perspektive als komplexer und schwer zu fassender Prozess.
Die Studie zeigt grundlegende theoretische und praktische Probleme des Interpretierens auf und entwickelt Lösungs-perspektiven zu Operationalisierbarkeit, Modellierung und Förderung von Interpretationskompetenz in den Sekundar-stufen I und II. Metakognitive Elemente und Strategien sind dabei von zentraler Bedeutung.