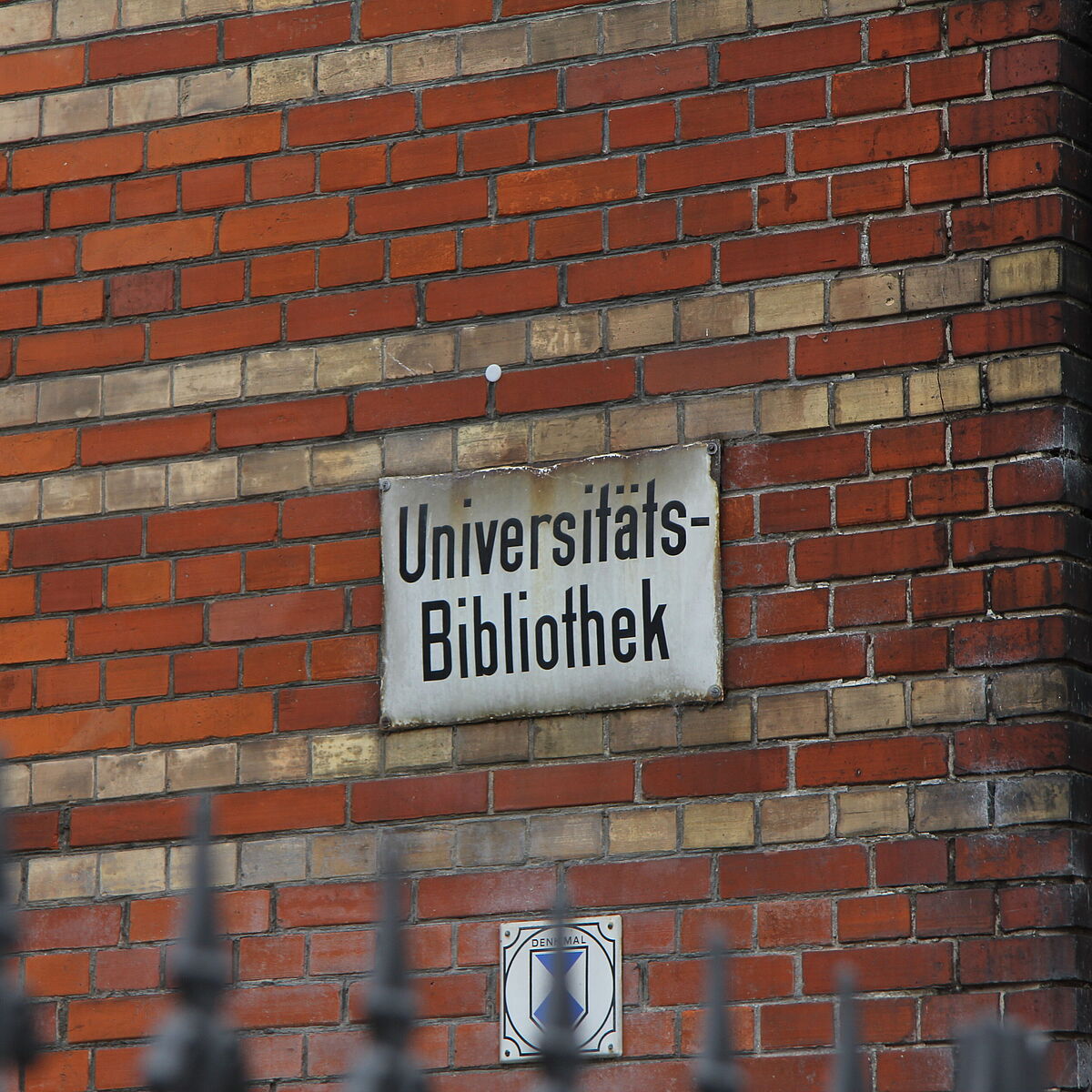Univ.-Prof. Dr. phil. habil. Konstanze Marx-Wischnowski
Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft

Arbeitsbereich Germanistische Sprachwissenschaft
Institut für Deutsche Philologie
Rubenowstraße 3 - Raum 2.04
17487 Greifswald
Telefon: +49 3834 420 3417
Telefax: +49 3834 420 3423
konstanze.marxuni-greifswaldde
Sprechzeiten im Sommersemester
Dienstag: 9:30 bis 10:30
Bitte melden Sie sich dazu in meinem digitalen Büro an.
Achtung NEU: Prüfungsanmeldung Staatsexamen