OER in der Lehrer*innenausbildung im Fach Niederdeutsch
Open Educational Resources (OER) bilden einen der drei zentralen Aspekte des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln (LeNie).




Besonders ein kleines Fach wie das Niederdeutsche sieht sich im universitären Lehrbetrieb mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Um die Ausbildung zukünftiger Niederdeutschlehrer*innen zu stärken, möchte das Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie) die Synergieeffekte interuniversitärer und kooperativer Lehre fördern. Aus diesem Grund hat sich LeNie zum Ziel gesetzt, kooperative, digital gestützte Lehrformate zu erproben. So wird die Lehr-Lern-Situation für Studierende und Lehrende verbessert und das Lehrangebot an den jeweiligen Hochschulen erweitert.
Um die Aus- und Weiterbildung zukünftiger Niederdeutschlehrer*innen zu verbessern, strebt LeNie den Ausbau der interuniversitären Kommunikation an, indem es kooperative und kollaborative Forschung und Lehre durch den Einsatz von Open Educational Resources - OER - fördert. Freie Bildungsmaterialien (OER) ermöglichen den Austausch fachlicher Expertise, steigern die Reputation der Lehrperson und können eine Entlastung im Lehrbetrieb darstellen. Auch der Wissenschaftsrat weist in seinen Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre auf das vielfältige Potenzial und eine bessere Nutzung von OER hin. (WR 2022, 48)
Damit OER die Lehre an den einzelnen Hochschulen bereichern können, müssen diese für das Fach Niederdeutsch jedoch zunächst erstellt werden. Hierfür gibt das Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie) den Hochschullehrenden Raum, um kooperativ und kollaborativ freie Bildungsmaterialien zu entwickeln. So wird im Netzwerk sowohl eine technische als auch fachliche Unterstützung bei der Erstellung von OER bereitgestellt. Durch den hohen Stellenwert des kooperativen Arbeitens im Lehrnetzwerk fördert es intrinsisch den Ausbau der interuniversitären (Lehr-)Kooperationen im Fach Niederdeutsch.
Podcast als OER
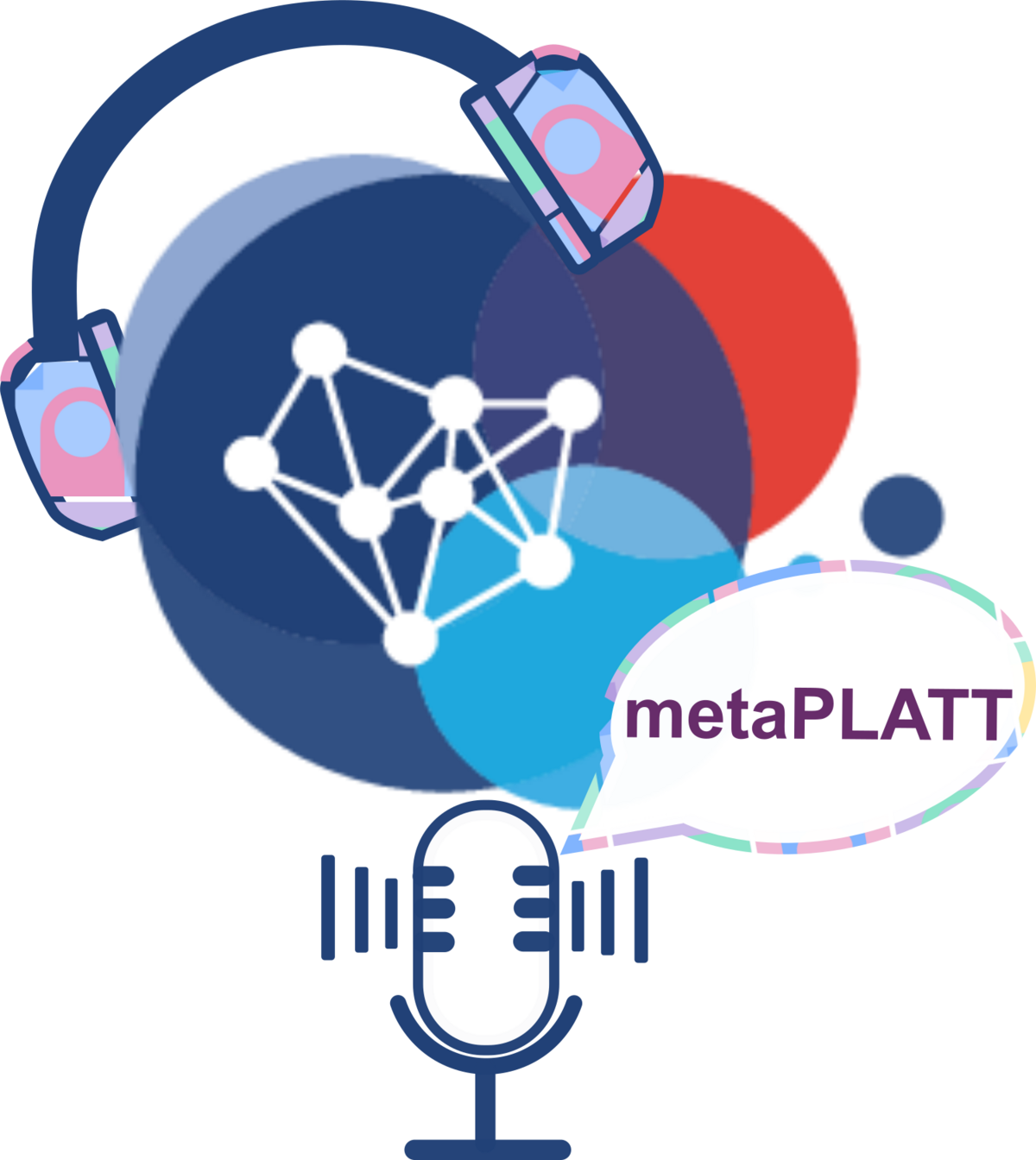
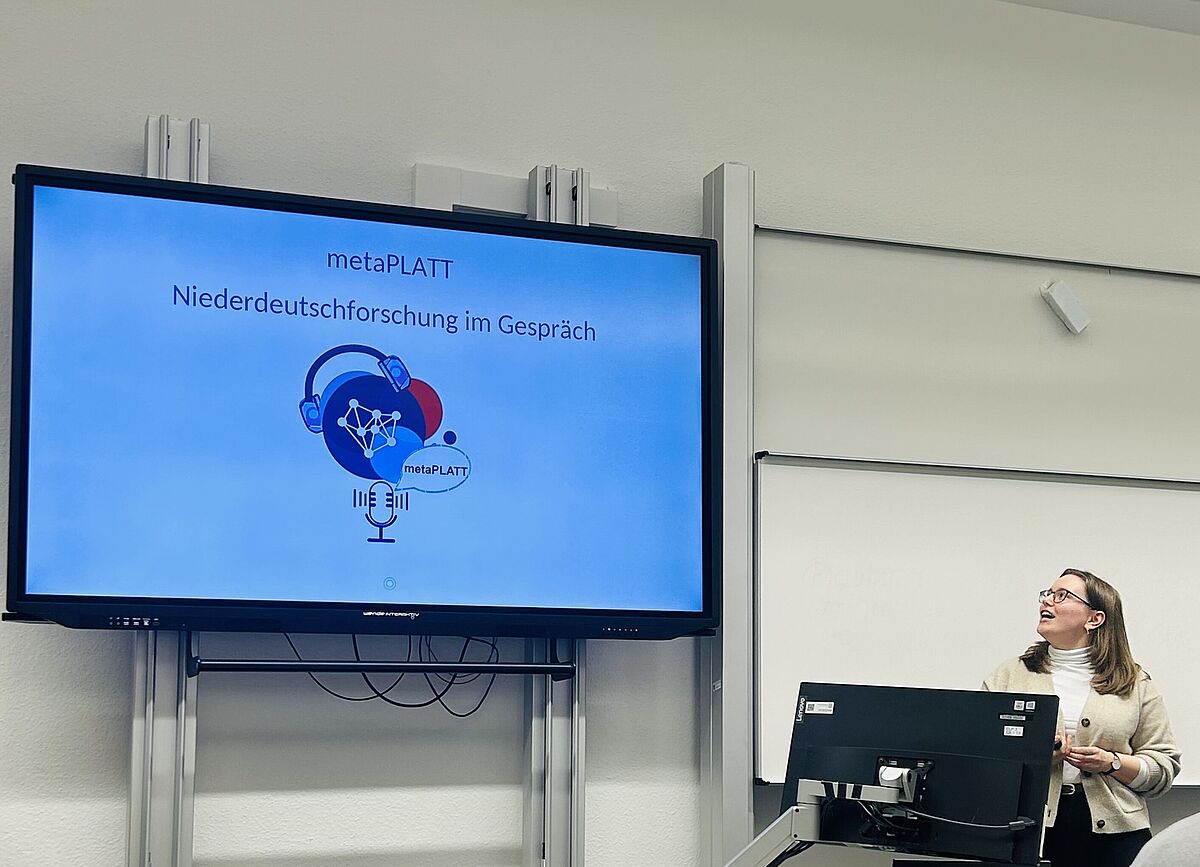
metaPLATT - ein Beispiel für eine OER aus dem Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie)
Unser Podcast metaPLATT - Niederdeutschforschung im Gespräch ist ein Beispiel für eine OER aus dem Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie). Der Podcast hat das Ziel, den Facettenreichtum der Forschung zum Niederdeutschen aufzuzeigen und aktuelle Fragestellungen der Forschung in einem einfach zugänglichen Medium sowohl Studierenden und Lehrenden des Niederdeutschen sowie weiterer germanistischer und philologischer Fächer als auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das metaPLATT-Team besteht zur Zeit aus Anne Hertel (Executive Producer und Produzentin), Annelie Steinbach, Inga Hafenstein und Prof. Dr. Birte Arendt (Executive Producer).
Was ist metaPLATT? metaPLATT ist eine OER, die an der Universität Greifswald als Kopf des Lehrnetzwerks produziert wird. In Einzelinterviews oder angeregten Gruppendiskussionen kommen Expert*innen aus dem Netzwerk zu ihren aktuellen Forschungsprojekten und -fragen zu Wort. Der Podcast umfasst die Themen Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Sprachgeschichte, Sprachpraxis und Niederdeutschdidaktik und kann so die Vielfältigkeit der Niederdeutschen Philologie aufzeigen.
Warum ist metaPLATT eine OER?
Die Tonaufnahme bildet als Bildungsmaterial (R) die Grundlage für die Arbeit und den Ausgangspunkt des Vorhabens. Diese konnte das Team um Anne Hertel mit freundlicher Unterstützung in den Räumen des DigiL@b des Instituts für Deutsche Philologie aufnehmen. In welchem Sinne sind die Podcasts nun educational (E) und open (O)? Der Podcast vermittelt Wissen in Form von Interviews und ist in diesem Sinne bereits Bildungsmaterial. Darüber hinaus sind die Audioelemente so konzipiert, dass sie zum Einstieg in oder zur Vorbereitung auf eine Seminarsitzung genutzt werden können. Zusätzlich ist in jede Folge mindestens eine vorbereitende oder weiterführende Aufgabe für die Studierenden integriert sowie ein Impuls für eine anschließende Diskussion im Seminar. So können die Podcasts in mehrfacher Hinsicht zum Wissenserwerb genutzt werden. Der Podcast bietet allen Interessierten eine Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern und einen Einblick in aktuelle Forschungsvorhaben zu bekommen. Das dritte Kriterium bezieht sich auf den Aspekt der freien Bildungsmaterialien (O). Der Podcast und somit auch das Wissen der Expert*innen ist in diesem Format niedrigschwellig nutzbar und kann auch im Unterricht an Schulen (Sek II) integriert werden. Des Weiteren stehen die Audioaufnahmen unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 und tragen den 5R-Freiheiten nach David Wiley Rechnung.
Wie unterstützt metaPLATT die Ziele des Lehrnetzwerks?
Der Podcast greift in seiner Form die Vorhaben des Lehrnetzwerks auf und verkörpert gleichzeitig die Ziele:
- im Sinne der Kooperation aller Expert*innen aus dem Netzwerk wird hier in medialer Form der Austausch von Wissen ermöglicht, der den Studierenden asynchron und unabhängig von der jeweiligen Hochschule zur Verfügung steht.
- Anhand des Podcasts kann das Netzwerk nun erproben, wie und ob sich dieses Format als digital gestütztes Lehrformat für die Niederdeutschvermittlung an Hochschulen anbietet.
Warum bietet sich ein Podcast an?
Ein Podcast bietet sich aus Sicht des Netzwerks an, da die Beliebtheit des Mediums stetig steigt (vgl. Online-Audio-Monitor 2024) und eine Integration in den eigenen Seminarkontext vielfältig möglich ist und innovative Lehrformen, wie z.B. Flipped Classroom-Seminare unterstützt. Um den Rezipient*innen das Audioerlebnis so angenehm und zugänglich wie möglich zu gestalten, sind alle relevanten Informationen und Literaturangaben in den Shownotes aufgelistet.
Haben wir Ihr Interesse wecken können? Dann finden Sie den Podcast metaPLATT hier.
Shownotes zu Folge 1: Von der Tradition zur Innovation: Der Wenkerbogen im digitalen Zeitalter – ein Gespräch mit Dr. Lisa Dücker
In der ersten Folge von metaPLATT sprechen wir mit Dr. Lisa Dücker, Philipps Universität Marburg, über die Wenkerbögen, eine einzigartige Sammlung von Dialektumfragen aus dem 19. Jahrhundert. Wer war Georg Wenker? Was sind Wenkerbögen eigentlich? Erfahre, wie diese Bögen die Grundlage für den „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ bildeten und wie sie heute noch für Forschung und Lehre ein unerschöpfliches Potenzial bieten. Dich interessiert auch, wie die Wenkerbögen in der digitalen Welt verwendet werden können, um die Sprachgeschichte zu erforschen? Dann wirf mit uns einen Blick in die Wenkerbogen-App.
Schlagworte: Wenkerbögen, Georg Wenker, Sprachatlas, Niederdeutsch, REDE SprachGis, Dialektologie, Sprachgeschichte, Digitalisierung, Regionalsprache, Binnendifferenzierung, Lautverschiebung, Einstieg in ein Seminar
Du willst das Wissen anwenden und vertiefen? Hier sind Anwendungsaufgaben
- Recherchiert Euren Geburtsort in der App! Vergleicht die Ergebnisse dort mit eigenen Übersetzungen von max. 5 Wenkersätzen in Eurem Dialekt.
- Sucht Bögen aus fünf Orten aus Schleswig-Holstein entlang der heutigen Staatsgrenze zu Dänemark. Stellt die Befunde zu Niederdeutsch, Standarddeutsch und Dänisch tabellarisch anhand drei ausgewählter Wenkersätze zusammen und vergleicht die Orte nördlich und südlich der Grenze miteinander.
Du willst mehr erfahren? Hier sind weiterführende Links und Informationen:
- Wenkerbogen-App: https://wenker.online.uni-marburg.de/wenker/
- Robert Engsterhold & Elvira Glaser (2023): Ein Jahr Wenkerbögen-App. In: Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas 3(5). https://www.sprachspuren.de/ein-jahr-wenkerboegen-app/
- Lisa Dücker (2023): Unsere Berge sind nicht sehr hoch, die euren sind viel höher – Deutsche Dialekte untersuchen mit den Wenkersätzen. Blogbeitrag von [di.tsvi.bl]. Ein Blog über Sprache. https://derzwiebel.wordpress.com/2023/07/04/deutsche-dialekte-untersuchen-mit-den-wenkersatzen/
Die Audio-OER und ihre Inhalte sind- sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BY-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: “Von der Tradition zur Innovation: Der Wenkerbogen im digitalen Zeitalter – ein Gespräch mit Dr. Lisa Dücker” von Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie), Lizenz: CC BY-SA 4.0. Die Inhalte der Shownotes sowie die weiterführenden Links sind von der Lizenz ausgenommen.
Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
Shownotes zu Folge 2: Zwischen den Sprachen: Dr. Viola Wilcken erklärt das Phänomen Missingsch
In der zweiten Folge von metaPLATT sprechen wir mit Dr. Viola Wilcken, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, über Missingsch, eine historische Sprachform, und wir gehen der Frage nach, wie Missingsch in Bezug auf das Niederdeutsche und das Hochdeutsche einzuordnen ist. Unsere Expertin erklärt uns, warum und inwiefern Missingsch eine Mischsprache ist, welche lautlichen und morphosyntaktischen Merkmale das Missingsch kennzeichnet und wie Missingsch in der Literatur verwendet wurde. In dieser Folge erforschen wir die komplexe Geschichte und den aktuellen Status von Missingsch und geben zwei mögliche Anwendungsbeispiele.
Schlagworte: Missingsch, Niederdeutsch, Sprachgeschichte, Literatur, Sprachkontakt, Hochdeutsch, Einführung
Du willst das Wissen anwenden und vertiefen? Hier sind Anwendungsaufgaben
1: Hört eine Folge der Radiocomedy „Frühstück bei Stefanie“ und prüft, an welchen Stellen die Sprache der Figuren von der hochdeutschen Sprache abweicht. Benennt sprachliche Merkmale.
Verlinkung zur Folge „Freizeitparkfeeling“ der Radio-Comedy „Frühstück bei Stefanie“; https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:publication:0bea8ad923cb08ad/
2: Schaut eine Folge „Neues aus Büttenwarder“. Beobachtet, wie welche Figur spricht. Notiert, welche sprachlichen Merkmale diese realisiert und überlegt, in welcher Weise die eingesetzte Varietät funktionalisiert wird.
Verlinkung zur Folge „Dorfschule“ der Comedy „Neues aus Büttenwarder“; bis Minute 11.30 https://www.ardmediathek.de/video/neues-aus-buettenwarder/dorfschule/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS8xMjlfMjAyMi0wOS0xNy0xNi00NQ
Du willst mehr erfahren? Hier sind weiterführende Links und Informationen:
- Wilcken, Viola: Hamburger Missingsch gestern und heute. In: Bieberstedt, Andreas/Jürgen Ruge/Ingrid Schröder (Hrsg.): Hamburgisch. Struktur, Gebrauch, Wahrnehmung der Regionalsprache im urbanen Raum. Frankfurt/M. u. a.: 2016, S. 215–249.
- Jürgens, Carolin: Niederdeutsch im Wandel. Sprachgebrauchswandel und Sprachwahrnehmung in Hamburg. Hildesheim/ Zürich u.a.: Olms 2015.
- Loewenberg, Jakob: In Gängen und Höfen. Hamburg: Glogau 1907. Digitalisat der UB Paderborn: Paderborn: Universitätsbibliothek Paderborn 2014. https://digital.ub.uni-paderborn.de/retro/urn/urn:nbn:de:hbz:466:1-29327
- Falke, Gustav: Die Kinder aus Ohlsens Gang. Braunschweig: Georg Westermann 1923. Link zum Datensatz der DNB: https://d-nb.info/573075670
- Möller, Vera: Klein Erna. Ganz dumme Hamburger Geschichten nacherzählt und gezeichnet. Gesamtausgabe. Gütersloh: Bertelsmann Lesering 1963. Link zum Datensatz der DNB: https://d-nb.info/453440266
Die Audio-OER und ihre Inhalte sind- sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BA-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: “ Zwischen den Sprachen: Dr. Viola Wilcken erklärt das Phänomen Missingsch” von Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie), Lizenz: CC BA-SA 4.0. Die Inhalte der Shownotes sowie die weiterführenden Links sind von der Lizenz ausgenommen.
Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
Die Inhalte der Shownotes und weiterführende Links sind von der Lizenz ausgenommen.
Shownotes zu Folge 3: Das REDE SprachGIS: Sprachkarten, Audiomaterial und so viel mehr mit Marina Frank
In der dritten Folge von metaPLATT sprechen wir mit Marina Frank, Philipps Universität Marburg, über das REDE SprachGIS, ein Forschungstool zur Visualisierung von Regionalsprachen. Erfahre, was sich hinter REDE SprachGIS verbirgt und welches Potenzial es für den Niederdeutschunterricht bietet. Mit REDE SprachGIS können Sprachatlanten und Tonaufnahmen genutzt werden, um Sprachwandel zu betrachten und Lernende für die Vielfalt der Sprache zu sensibilisieren.
Schlagworte: Sprachatlas, Niederdeutsch, REDE SprachGis, Sprachdidaktik, Mediendidaktik, Wenkerbögen, Variationslinguistik, Dialektologie, Sprachgeschichte, Regionalsprache, Sprachwandel, Interaktion, Einstieg
Du willst das Wissen anwenden und vertiefen? Hier sind Anwendungsaufgaben
1: Schaut euch das folgende Beispielvideo über die Anwendung von REDE SprachGIS an und erstellt eine eigene Karte zum Phänomen des Einheitsplurals im Niederdeutschen.
2: Diskutiert, welche Vor- und Nachteile eine solche digitale Kartierung im Vergleich zu traditionellen sprachwissenschaftlichen Methoden hat und welche Möglichkeiten sich für den Niederdeutschunterricht ergeben.
Du willst mehr erfahren? Hier sind weiterführende Links und Informationen:
- Frank, Marina/Lang, Vanessa: Niederdeutsch vermitteln mit dem REDE SprachGIS. In: Sprachspuren: Berichte aus dem Deutschen Sprachatlas 3(8) 2023. https://doi.org/10.57712/2023-08
- REDE Regionalsprache.de https://www.regionalsprache.de/
- REDE SprachGIS: https://www.regionalsprache.de/SprachGis/Map.aspx
- Wenkerborgen-App: https://wenker.online.uni-marburg.de/wenker/
Die Audio-OER und ihre Inhalte sind- sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BY-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: “Das REDE SprachGIS: Sprachkarten, Audiomaterial und so viel mehr mit Dr. Marina Frank” von Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie), Lizenz: CC BY-SA 4.0. Die Inhalte der Shownotes sowie die weiterführenden Links sind von der Lizenz ausgenommen.
Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
Die Inhalte der Shownotes und weiterführender Links sind von der Lizenz ausgenommen.
Folge 4: Von Wörtern und Karten: Die digitale Erfassung von Dialekten im Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW) mit Prof. Dr. Helmut Spiekermann
In der vierten Folge von metaPLATT sprechen wir mit Prof. Dr. Helmut Spiekermann, Universität Münster, und seinen beiden Mitarbeiter*innen Gero Gehrke und Stephanie Sauermilch über den Dialektatlas Mittleres Westdeutschland – kurz DMW. Der DMW ist ein digitaler Atlas, der die phonologischen, lexikalischen und syntaktischen Merkmale darstellt und einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Sprachgeschichte und der Sprachvielfalt in der Region leistet. Du erfährst, wie das Projekt entstanden ist, welche Herausforderungen es zu überwinden gilt, wie es die sprachliche Vielfalt in der Region aufzeigen kann und wie der Atlas zum Einsatz in deinem Unterricht kommen kann.
Schlagworte: Dialektatlas, Niederdeutsch, DMW, Dialektatlas Mittleres Westdeutschland, Dialektologie, Sprachgeschichte, Regionalsprache, Sprachwandel, Mediendidaktik, Einstieg
Du willst das Wissen anwenden und vertiefen? Hier sind Anwendungsaufgaben
1: Schaut euch die vier einführenden Videos zu Funktion und Umgang mit dem Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW) an. Nutzt hierfür den Link zu den Atlaskarten.
2: Nutzt den Zugang zu den Atlaskarten und erstellt eine Karte zu einem Ort eurer Wahl.
Du willst mehr erfahren? Hier sind weiterführende Links und Informationen:
- Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW): https://www.dmw-projekt.de/
- Atlaskarten: https://www.dmw-projekt.de/#projekt
- Spiekermann, Helmut: Phonologischer Wandel: „das“ und „dat“ digital erforschen. In: Der Deutschunterricht. Sprachgeschichte und Sprachwandel. Jg LXXVI. 2/2024. Hannover: Friedrich Verlag, S. 5-13.
Die Audio-OER und ihre Inhalte sind- sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BA-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: “Von Wörtern und Karten: Die digitale Erfassung von Dialekten im Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW)” von Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie), Lizenz: CC BA-SA 4.0. Die Inhalte der Shownotes sowie die weiterführenden Links sind von der Lizenz ausgenommen.
Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
Shownotes zu Folge 5: Niederdeutschdidaktik medial inklusiv gedacht – ein Gespräch mit Prof. Dr. Cornelius Herz und Dr. Söhnke Post
Zusammenfassung:
In der heutigen Folge von metaPLATT sprechen wir mit Prof. Dr. Cornelius Herz und Dr. Söhnke Post von der Leibniz-Universität Hannover über die Rolle des Niederdeutschen in Niedersachsen. Wir sprechen über die Bedeutung des Hochdeutschen und des Niederdeutschen für den Raum Hannover und diskutieren, wie das Niederdeutsche in Schule und Gesellschaft wahrgenommen wird und wie es sich in der digitalen Welt ändern könnte. Anforderungen an einen modernen Niederdeutschunterricht werden ebenso diskutiert wie de Frage, inwiefern das Hannoversche-Modell zur Literatur- und Mediendidaktik eine Antwort hierfür bieten könnte. Also bleibt gespannt und hört rein!
Schlagworte: Niederdeutschdidaktik, Literatur- und Mediendidaktik, Digitalisierung, sprachliche Rezeption, sprachliche Produktion, kulturelle Sinnstiftung, Sprachenpolitik, Einführung
Du willst das Wissen anwenden und vertiefen? Hier sind Anwendungsaufgaben
1: Diskutiert, wie der Niederdeutschunterricht der Zukunft aussehen könnte.
2: Beobachtet eure Umgebung und beantwortet folgende Frage: Wo finde ich aktuelle Angebote des Niederdeutschen in der digitalen und analogen Welt? Sammelt die Ergebnisse und besprecht diese im Seminar.
Du willst mehr erfahren? Hier sind weiterführende Links und Informationen
- Herz, Cornelius/ Post, Söhnke/ Krüger, Johannes (2026 i. Dr.): Kompetenzbereichsübergreifender Niederdeutschunterricht. Antinomien und Lösungswege einer (digitalen) Literatur- und Mediendidaktik im 21. Jahrhundert. In: Birte Arendt/Franziska Buchmann/Robert Langhanke (Hrsg.): Integrative Niederdeutschdidaktik. Perspektiven auf Schule und Universität. Berlin.
- Conrad, François/ Ehrlich, Stefan (2022): Das DFG-Projekt „Die Stadtsprache Hannovers“. In: Korrespondenzblatt des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 129, 61–75.
Die Audio-OER und ihre Inhalte sind- sofern nicht anders angegeben - lizenziert unter CC BY-SA 4.0. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: “Niederdeutschdidaktik neu gedacht – ein Gespräch mit Prof. Dr. Cornelius Herz und Dr. Söhnke Post” von Lehrnetzwerk Niederdeutsch vermitteln (LeNie), Lizenz: CC BY-SA 4.0.
Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
Die Inhalte der Shownotes sind von der Lizenz ausgenommen.
