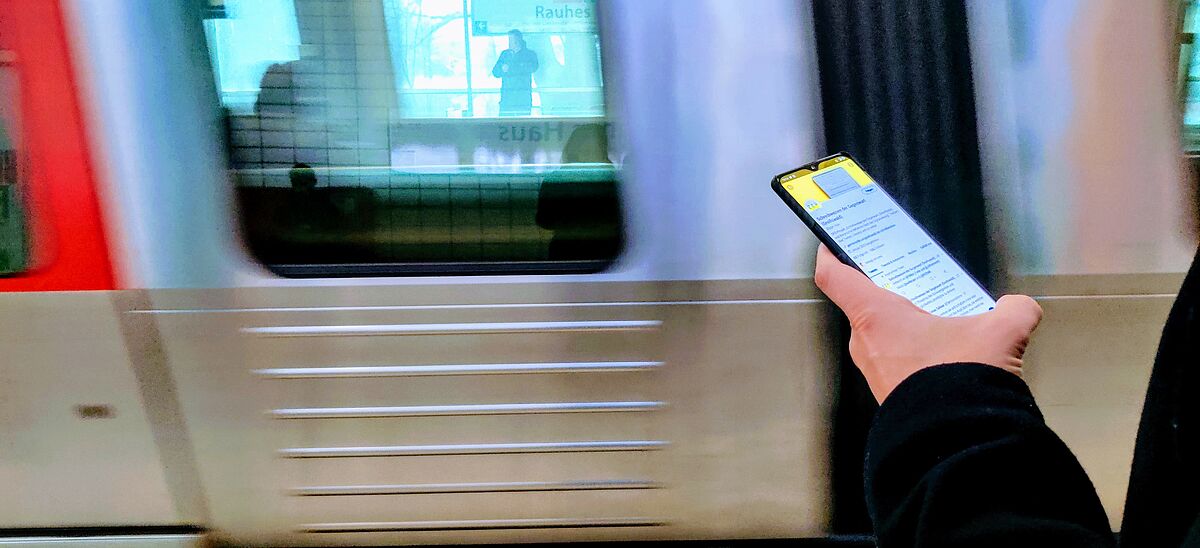Von Anna Hofman (Hamburg), Leonie Sroka (Bern) und Hannah Willcox (Greifswald)
Wie stellt Gegenwartsliteratur Konzepte von Zeit dar? Zu welchen Reflexionen über Zeit und Zeitlichkeiten lädt sie ein? Wie verschränken Schreibweisen der Gegenwart zeitliche und politische Dynamiken in Bezug auf soziale Gerechtigkeit und Repräsentation? Während einer intensiven Woche vom 30. Juni bis zum 4. Juli trafen sich Doktorand*innen aus Deutschland, der Schweiz, den USA und Belgien im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg an der Universität Greifswald, die sich mit jenen komplexen Schreibweisen auseinandersetzen, mit denen seit einigen Jahren überkommene Auffassungen der Relation von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft problematisiert, alternative Formen der Zeitreflexion und Zeitdarstellung entwickelt und so aktuelle gesellschaftliche Dynamiken verhandelt werden. Während der gesamten Sommerschule tauschten sich die Teilnehmer*innen in Seminaren, Vorträgen und Präsentationen zu den Themen ihrer jeweiligen Dissertationsprojekte (im Bereich Neuere deutsche Literatur und Komparatistik) sowie zu ausgewählten literarischen und theoretischen Texten im Gespräch mit den Gastdozent*innen Prof. Dr. Sarah Colvin (Cambridge) und Prof. Dr. Philipp Theisohn (Zürich) aus. Die Seminare und Theoriediskussionen, für die die Teilnehmer*innen Olivia Wenzels 1000 Serpentinen Angst (2020) und Christian Krachts AIR (2025) sowie Theorietexte von Priscilla Layne, Karen Barad, Manuela Rossini und Mike Toggweiler lasen, hatten unterschiedliche Formate, darunter Diskussionen in kleineren und größeren Gruppen. Die Sommerschule wurde von Prof. Dr. Eckhard Schumacher (Neuere deutsche Literatur und Literaturtheorie, Greifswald) konzipiert und geleitet, unterstützt durch Philo Ohnesorge und Hannah Willcox. Das Ziel der Sommerschule, den Umgang mit Zeit im gegenwärtigen Schreiben zu untersuchen, führte während der sonnigen Woche zu produktiven und konzentrierten Gesprächen über Themen wie Zukunft, Generationalität und kulturelles Gedächtnis, geologische Tiefenzeit, Linearität als zu hinterfragendes Konzept, Archivierung, Glitches und Metaphern für Zeit wie Netzwerke, Flüsse, Schichten, Zyklen und Serpentinen. Die anregenden Sitzungen erstreckten sich bis in die Pausen, die bei hochsommerlichem Wetter zu weiteren Austauschmöglichkeiten einluden. Die Sommerschule war eine zweisprachige Veranstaltung, die Teilnehmer*innen und Professor*innen zum Austausch auf Deutsch und Englisch einlud.
Montag, 30.6.
Helene Weinbrenner (Basel) eröffnete die Sommerschule mit einem Beitrag zu „Zukünftigen Generationen in Barbi Marković's Minihorror (2024)”. Sie untersuchte die Denkfigur zukünftiger Generationen als literarische Zeitreflexion. Hannah Willcox (Greifswald) griff die Diskussion um Zukünftigkeit mit ihrem Beitrag „Zukunftsschwanger? Geburt und Wiedergeburt in postmigrantischer Gegenwartsliteratur” auf und analysierte Geburtsszenen, in denen Formen zeitlicher Wiederkehr und Widerständigkeit zum Tragen kommen. Den Blick auf Romane von Sasha Marianna Salzmann und Fatma Aydemir richtend, untersuchte Laura Maria Sturtz (Erlangen-Nürnberg) in ihrem Beitrag „Etwas erinnert sich: Temporale Strukturen und literarische Interventionsstrategien” die Intersektion von Literatur, Zeit und sozialer Gerechtigkeit. Die gemeinsame Diskussion betraf Gedanken zur temporalen Struktur der Wiederholung mit Differenz, zu Linearität als dominante Zeitkonzeption und zur Relevanz, politische Fragestellungen mit Schreibweisen kurzzuschließen. In Kleingruppen intensivierte sich die Diskussion zu körperlichen Verletzungen und struktureller, rassistischer Gewalt der Gegenwart in Sarah Colvins (Cambridge) Seminar zu nekropolitischer Zeit in Wenzels 1000 Serpentinen Angst. Spiralen unendlicher Gewalt wurden nachgezeichnet und die Teilnehmer*innen sprachen über Modi des Erinnerns und Schreibweisen, durch die der Roman seiner Erzählerin Raum schafft, um ihre Geschichte zu erzählen. Unsere Gespräche profitierten besonders von der Lektüre von Priscilla Laynes Arbeiten zum Afro-Deutschen Afrofuturismus und Michelle Wrights Überlegungen zu einer epiphänomenalen Zeit. So konnte am Dienstagmorgen ein stärkerer Fokus auf Bewegung, Fluidität und transtemporale literarische Strategien gelegt werden. Im gemeinsamen Close Reading einiger Romanpassagen sprachen die Teilnehmer*innen über verschiedene Analyseebenen, von grammatischem Modus zu thematisch werdender Zeitreflexion, und brachten fluide Zeitmetaphern in einen Dialog mit Fließ- und Serpentinenbewegungen und körperlicher Bewegtheit in Wenzels Text.
Dienstag, 1.7.
Die Nachmittagssession öffnete die Diskussion für eine verstärkte Beschäftigung mit dem Verhältnis von Genre und Zeit. Tim Senkbeil (Greifswald) analysierte die kompositionelle Relevanz der Zeitgestaltung in seinem Beitrag „Wende erzählen. Zeitgestaltung in der deutschsprachigen Nachwendeliteratur”. Madeline Zimring (Berkeley) gab im Anschluss Einblicke in „Exofiction in the Conditional Mood: Imagining (Family) History in Andreas Maier’s Das Zimmer” und untersuchte die Verflechtung von Wahrheitsbehauptung, Fürsprache und irrealer Modi. Die Anschlussdiskussion fokussierte noch einmal Schreibszenen, die als Reflexionsmomente eine doppelte Zeitstruktur der Retrospektion und des Erinnerns einsetzen, die sowohl den Wahrheitsgehalt der Erzählung als auch die Lücken im Wissen über die Vergangenheit permanent ausstellt. Sarah Colvins öffentlicher Abendvortrag „Haunting times: Ghosted memory and epistemic revenants in Serhiy Zhadan’s Voroshilovgrad (2010) and NoViolet Bulawayo’s Glory (2022)” nahm viele der Diskussionsstränge der ersten beiden Tage wieder auf und erweiterte diese gleichzeitig um komparatistische Perspektiven. Colvin untersuchte, wie die Romane die repressive Praxis des epistemischen Ghostings entlarven und die widerständige Praxis der epistemischen Heimsuchung inszenieren. Diejenigen, die geghosted wurden, kehren widerständig zurück und führen dabei Erinnerungen und Geschichte zurück, womit sie ein lineares Gedächtnismanagement komplizieren. Als nomadische Subjekte, die sowohl konzeptuelle als auch zeitliche Grenzen überschreiten, destabilisieren sie die nekropolitische Kontrolle der Lebenden im Angesicht der Sterblichkeit und ermöglichen so eine epistemische Gerechtigkeit.
Mittwoch, 2.7.
Der Mittwochmorgen begann mit einer Theoriediskussion, in der wir unsere Lektüren von Karen Barad’s „Troubling time/s and ecologies of nothingness: re-turning, re-membering, and facing the incalculable” (2017) miteinander teilten. Zwei zentrale Themen der Diskussion waren Skalierung und Linearität. Philo Ohnesorge (Greifswald) gab einen einleitenden Impuls, der nicht nur die Enthüllung des Quantenradierers als „empirical evidence for a hauntology” hervorhob, sondern auch eine intensive Diskussion zu transdisziplinärer Wissensproduktion anregte, in der die Teilnehmer*innen die Resonanzen zwischen literarischen und quantenphysikalischen Zeitkonzepten besprachen. Eckhard Schumacher (Greifswald) hielt daraufhin einen Vortrag mit dem Titel „Glitches, Mud & Muddle – Gegenwartsliteratur, Theorieentwürfe und Zeitreflexion im Anthropozän-Diskurs”. Dies regte eine Diskussion über troubling times und Glitches an; Störungen der Linearität, kleine Verschiebungen, die zu (politischem) Wandel führen können. Weiter ging es mit dem Thema Politik und Zeit bei Anna Hofman (Hamburg) mit ihrem Vortrag „Portals of Memory: Traversing Linear Conceptions of Time through Poetry/Film”, der sich auf Inszenierungen generationenübergreifender Beziehungen sowie auf Reflexionen über räumlich-zeitliche Bewegungen durch Erinnerungsakte wie das Schreiben konzentrierte. Anne Hilgers (Köln) dachte in ihrer Präsentation „Tricksterzeiten – Temporale Störung als ästhetische Strategie bei Ann Cotten” über Subversion und wechselseitige literarische Strukturen wie Ordnung und Chaos, Stabilität und Wandel nach. Das Plenum sprach über Bewegung durch Raum und Zeit und kam zum Schluss, dass Störungen einen Moment der Gegenwart herstellen. Sie sind zudem ein ausgestellter Stillstand, der wiederum zu Variation und einer anderen Zukunft führen kann. Dabei können Figuren, Glitches oder auch die Literatur und Film als Medium „stören”. Der Tag endete im Greifswalder Koeppenhaus mit einer Lesung und einem Gespräch zu „Thomas Manns Rundfunkreden ‚Deutsche Hörer!‘ Radiosendungen nach Deutschland”.
Donnerstag, 3.7.
Im Seminar von Philipp Theisohn (Zürich) wurden Zeitdarstellungen in Krachts AIR diskutiert. Die Teilnehmer*innen befassten sich zuerst vertieft mit der Verfasstheit der Diegese und der Kulisse, die zu Beginn des Romans geschaffen wird und sich durch ihren Schwebe-Zustand auszeichnet. Wohingegen die andere Welt des Romans von Nostalgie, Fantasie, Reduktion und Gewalt geprägt ist. Das weiße rettende Pulver, das der Protagonist von einer Welt in die andere überführt, ist kennzeichnenderweise ein Antibiotikum – „gegen das Leben”. Neben der Eigenzeit von Material, etwa der Aufwertung eines Gegenstandes durch Patina, war auch die Dimensionalität von Interesse, so wird die andere Welt im Roman immer zweidimensionaler. Anschließend an unsere Diskussion vom Mittwoch, konnten auch AIR Glitches sowie Neuanordnungen diagnostiziert werden, die an KI denken lassen. Nicht zuletzt besprachen Teilnehmer*innen, dass Geschlechterdarstellungen im Roman wie in der Zeit stehen geblieben wirken, beispielsweise durch den Fakt, dass die weiblichen Figuren vor allem Care-Aufgaben übernehmen. Im weiteren Verlauf des Donnerstags standen Archive und verschiedene Zeitmetaphern im Fokus. Auf Basis des Vortrags von Nina Doejen (Wuppertal): „‘Wäre nächsten Sonntag Bundestagswahl […]‘: Zeitdarstellungen und Gegenwartsdiagnosen in Saša Stanišićs autofiktionalen Texten” wurde besprochen, inwiefern Social Media als Teil des Werks gilt, das es zu archivieren lohnt. Während das Plenum nach dem Vortrag von Leonie Sroka (Bern): „Von Unberührtem und Zerfließendem. Zeit und Diskurse in Thomas Meineckes Jungfrau” dafür plädierte, den Pop- bzw. Diskursroman als Exponat seiner Zeit und nicht als unzugängliches Archiv einzuordnen. Der Tag wurde von Guillaume Etienne (Namur) mit „Die verborgenen Geschichten des Karsts: Zu Fuß durch Räume und Zeiten in Jan Röhnerts Vom Gehen im Karst (2021)” abgeschlossen. Dabei erweiterte er den Archivbegriff durch eine ökokritische Perspektive; Natur als (poröser) Erinnerungsspeicher und Palimpsest.
Freitag, 4.7.
Die Diskussion über die Verflechtung von Politik und zeitlichen Konzepten und Konfigurationen setzte sich auch am letzten Tag der Sommerschule fort, an welchem Teresa Sambruno Spannhoff (Durham, NC) über „Korrumpierte Zukunftsvisionen – Die Verbindung zwischen der kolonialen Terra Nullius-Wahrnehmung und der utopischen Imagination in Theresia Enzensbergers Auf See (2022)” sprach. Zusammen mit Philipp Nobis (Greifswald) Beitrag „Dem Dystopie-Backförmchen entglitten. Zu Sibylle Bergs Romanen GRM. Brainfuck und RCE. RemoteCodeExecution und ihr Verhältnis zur „Gattung der Utopie” regten die beiden Vorträge Diskussionen über die Reflexion von Gegenwart in literarischen Zukünften und in den utopischen/dystopischen Konzepten der Texte an. Sie unterstrichen, wie wichtig es ist, Ökokritik und posthumane Theorie im Zusammenhang mit Technologie und Ökonomie zu lesen und zu überlegen, wo es Überschneidungen mit postkolonialem Denken gibt. In der letzten Abschlusssitzung wurde diese Gedanken fortgesetzt und mit den vorangegangenen Überlegungen zu Linearität verknüpft. Ein zentrales Thema der Abschlusssitzung war die kritische Untersuchung des Begriffs „Apokalypse” und die Frage nach einem „Endpunkt”, der im Verhältnis zum Begriff „Katastrophe” zu sehen ist. Die abschließende Diskussion eröffnete neue Fragen über die Koexistenz von zeitlichen Konfigurationen und Metaphern, und dem Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie soll mit solchen Konzepten umgegangen werden und welche Assoziationen wecken sie? Was bedeutet es, wenn Literatur das Immerwährende und Gegenwärtige hervorhebt und die Zukunft nicht in eine ferne Unbekannte verschiebt?
Die produktive und erkenntnisreiche Woche war geprägt von einer offenen und angenehmen Diskussionsatmosphäre, in der sich zahlreiche Überschneidungen zwischen den unterschiedlichen Dissertationsprojekten zeigten, die zu weiterem Austausch anregten. Zu den vielen Höhepunkten zählten nicht nur der Sonnenuntergang am Greifswalder Hafen und ein Anruf von Christian Kracht, sondern auch der Plan, die Sommerschule zu wiederholen. Die Autorinnen bedanken sich bei allen Teilnehmenden, dem Organisationsteam und dem Alfried Krupp Wissenschaftskolleg für die tolle Woche und freuen sich auf zukünftige gemeinsame Projekte.