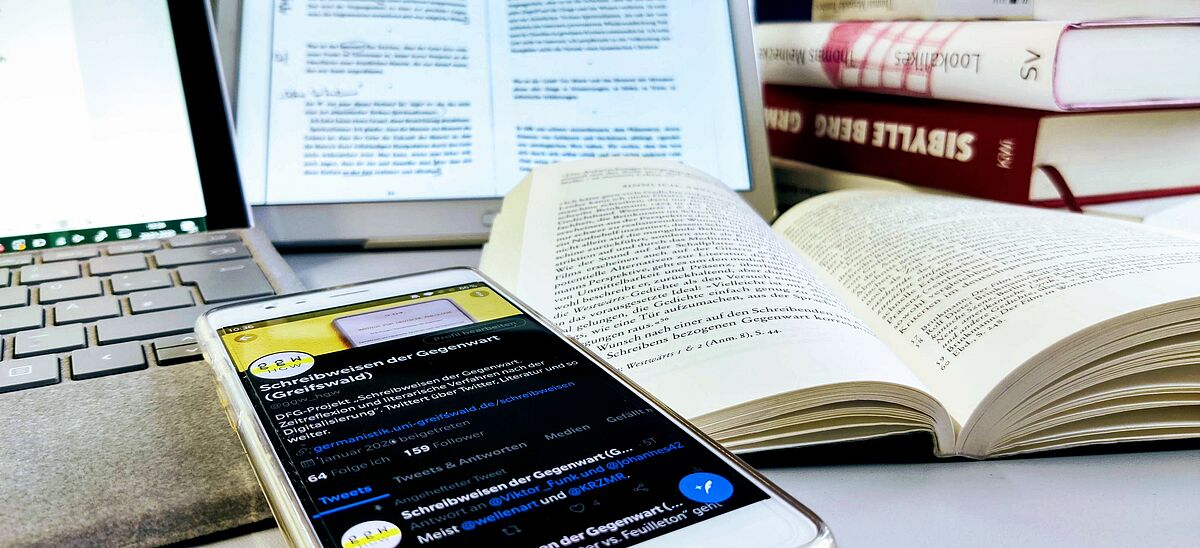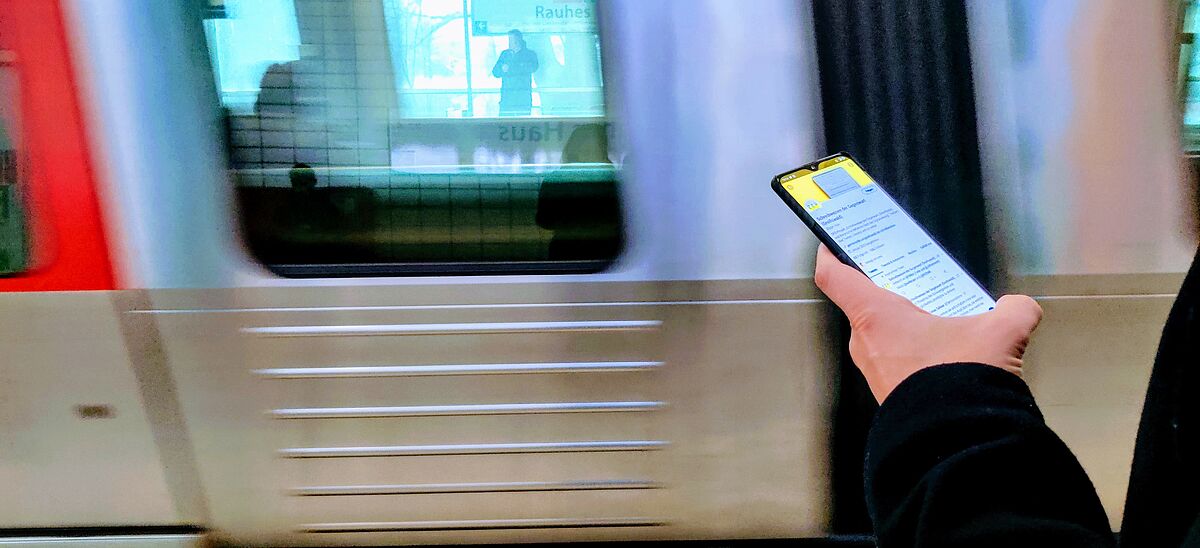Tagebücher als Krisenphänomen: Während der Corona-Pandemie tauchten vielerorts und in verschiedenen medialen Formaten Journale auf und werden zum Teil bis heute weiter fortgesetzt. Die Konjunktur des Tagebuchs wurde auch vom Feuilleton schnell als Thema aufgegriffen, wenn auch nicht unbedingt mit positiver Wertung. Julia Encke schrieb in der FAS vom 5. April von „Gedankenkitsch“ und urteilte, dass „mit diesem ganzen hohlen Pathos und der Trostprosa […] gar nichts gewonnen“ sei. Marie Schmidt verschob in der Süddeutschen Zeitung vom 16. April den Akzent ein wenig. Auch sie beschreibt zwar das „Protokoll der Krise“ als so „vielstimmig und wirr wie die Krise selbst“, stellt aber die Frage, wie denn überhaupt literarisch über sie zu schreiben sei. Beide greifen in ihren Beiträgen Fragen auf, die Kathrin Röggla schon in einem Text in der FAZ vom 21. März mit dem Titel „Prognosefieber“ thematisiert hatte: dass jene Versuche des Auf- und Mitschreibens vor allem in Hinblick auf Verschiebungen in der Zeitwahrnehmung zu perspektivieren seien. Literatur müsse sich einmal mehr als Zeitkunst beweisen. Diese Forderung steht im Kontext unzähliger Äußerungen zur Zeitwahrnehmung in der Corona-Pandemie, die im Philosophie-Magazin genauso zu finden sind wie im Tagesspiegel, in den Twitter-Timelines genauso wie in den angesprochenen Tagebüchern. Um diese geht es im Folgenden im Besonderen. Als Gegenstand der Diskussion im DFG-Forschungsprojekt dienten insbesondere das kollektive Tagebuch auf 54books, das Journal von Carolin Emcke in der Süddeutschen Zeitung sowie das mehrstimmige Tagebuch auf der Internetseite des Literaturhauses Graz unter Beteiligung von Kathrin Röggla. Dieser Text ist Teil einer Reihe, die hier im Blog in fünf Teilen erscheint und zuerst auf 54books veröffentlicht wurde. Dieser Text ist Teil einer Reihe, die hier im Blog in fünf Teilen erscheint und zuerst auf 54books veröffentlicht wurde.
Bis vor einigen Wochen war es noch die Digitalisierung, die von vielen für eine grundlegend veränderte Zeitwahrnehmung, eine radikale Fokussierung auf die Gegenwart und einen neuen Begriff von Gegenwart verantwortlich gemacht wurde. Dabei war nicht immer klar, ob durch die digitalen Medien nun eine „breite Gegenwart“ (Gumbrecht) entstanden ist, die von nicht vergehenden Vergangenheiten überschwemmt wird, oder ob der „present shock“ (Rushkoff) im Gegenteil eine Kultur des Präsentismus hervorgebracht hat, in der Vergangenes instantan vergessen wird. Und auch die Frage, ob alles immer schneller wird, wenn alles jetzt passiert, oder vielmehr Stagnation und Stillstand zu verzeichnen sind, blieb zwischen den divers zirkulierenden gegenwartsdiagnostischen Statusmeldungen offen. Einig war man sich nur darin, dass sich die Wahrnehmung und das Verständnis von Gegenwart krisenhaft verändert haben und dass diese Veränderungen mit dem Schlagwort der Digitalisierung erfasst und begründet werden können.
Das neue Coronavirus sorgt nun für eine merkwürdige Überlagerung und Verschiebung dieser Thesen, Debatten und Szenarien, für eine verschobene Wiederholung, die die einschlägigen Stichworte aus dem Digitalisierungsdiskurs – weltweite Netzwerke der Übertragung, der Zustand des always-on, permanente Aktualisierung – wie auch die entsprechende Krisenrhetorik auf einer anderen Ebene reproduziert und reanimiert. „In der Krise, die uns alle derzeit so fordert, erleben wir einen Moment enorm verdichteter und beschleunigter Gegenwart“, stellt, wie viele andere, Ende März 2020 der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Armin Laschet fest und folgert: „Das Jetzt fordert unsere ganze Aufmerksamkeit.“ Hier werden nun nicht die digitalen Medien, die alles auf die Gegenwart ausrichten, als Verursacher einer Krise identifiziert, der „Moment enorm verdichteter und beschleunigter Gegenwart“ wird vielmehr auf ein Virus zurückgeführt. Auf ein infektiöses, halblebendiges Etwas, das, wie zwischenzeitig spekuliert wurde, auf „nassen Märkten“, zwischen weggespültem Blut und Dreck, von Tieren auf den Menschen übergesprungen sein soll, mittlerweile aber weltweit zirkuliert und mehr oder weniger zeitgleich die ganze Menschheit betrifft.
Dass viele darüber im Modus ständig aktualisierter, sich schnell ausbreitender Updates informiert werden, ist dann aber doch wieder der Digitalisierung geschuldet, die das etablierte System der Massenmedien durch die Kanäle der Sozialen Medien maßgeblich ergänzt und erweitert, sodass sich ein merkwürdige Parallelität der Topik des Viralen ergibt: Der exponentiellen Ausbreitung des Virus korrespondiert in noch nicht hinreichend berechneten Ausmaßen die rasante, durchaus treffend als ‚viral‘ bezeichnete Ausbreitung von Nachrichten, Gerüchten und individuellen Statusmeldungen zum Virus – und mithin auch die Ausbreitung der Auffassung, dass es unsere Zeitwahrnehmung grundlegend verändert. Verstärkt wird dieser Eindruck auch dadurch, dass dieses Coronavirus neu ist und seine Aktivitäten wie deren Folgen in vielen Hinsichten unabsehbar sind. Selbst diejenigen, die sich professionell mit Viren befassen, wissen immer noch vergleichsweise wenig über es und müssen den zwischenzeitig erreichten Wissenstand permanent revidieren, korrigieren und aktualisieren.
Auch deshalb liegt es nahe, dass der unübersichtlich mehrgleisigen Zirkulation viraler Prozesse zwischen Menschen und Medien geradezu massenhaft mit dem Schreiben von Tagebüchern begegnet wird. Der Rekurs auf ein etabliertes, spätestens seit Samuel Pepys Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert zudem epidemieerprobtes Medium ermöglicht es, den diffus global zirkulierenden Bedrohungsszenarien mit einer individuell begrenzten, selbst fokussierten Perspektive zu begegnen, die durch die Veröffentlichung in den Sozialen Medien aber zugleich den Anschluss an andere oder auch den öffentlichen Diskurs ermöglicht, über die vermeintlich eigene Filterblase oder die weiter ausgreifenden Netzwerke digital vermittelter Kommunikation.
Als Medium der Fokussierung auf die Gegenwart, mit dem man das, was aktuell passiert, Tag für Tag festhalten kann, in dem Veränderungen (wie auch deren Ausbleiben) schrittweise notiert, reflektiert und, gegebenenfalls gleich am nächsten Tag, revidiert werden können, wirkt das Tagebuch der derzeitigen Situation auf besondere Weise angemessen. Da es zugleich einen Rahmen bildet, in dem ohnehin häufig über Zeitverhältnisse reflektiert wird, insbesondere über die Aporien und Paradoxien der schriftlich vermittelten Gegenwartsfixierung, ergeben sich schnell weitere Interferenzen mit eben der Situation, die durch das Virus entstanden ist.
Viele der aktuell entstehenden Corona-Tagebücher thematisieren nicht nur, sondern reproduzieren auch selbst jenes Neben- und Miteinander von Verlangsamung und Beschleunigung, das auch im politischen Diskurs den Eindruck eines „Moments enorm verdichteter und beschleunigter Gegenwart“ prägt. Einerseits liegt die „Halbwertszeit vom Neuigkeitswert“, wie Kathrin Röggla in ihrem Corona-Tagebuch auf der Website des Literaturhauses Graz feststellt, „bei ca. sechs Stunden“, andererseits ist, wie sie nahezu zeitgleich in einer Tageszeitung, der FAZ, ergänzt, „das öffentliche Leben stillgestellt, das Sozialleben eingefroren“. „Ich kann nicht Schritt halten, der Diskurs bewegt sich in rasender Geschwindigkeit vorwärts, die Situation kann sich jederzeit ändern. Was heute dementiert wird, ist morgen Realität“, reflektiert Röggla eine auch in vielen anderen Corona-Tagebüchern geteilte Wahrnehmung der aktuellen Situation. Wenn sie feststellt, dass sich alles „zu schnell“ bewegt und alles „morgen“ schon „durch neue Nachrichten“ abgelöst wird, beschreibt sie zugleich aber auch den üblichen Aktualisierungsmodus von Tagebuch und Tageszeitung. Der zeigt allerdings, trotz digitaler Vernetzung, in der gegenwärtigen Situation geradezu überdeutlich seine Grenzen: „Ich komme also nicht durch zu der Gegenwart der Lesenden“, schreibt Röggla angesichts einer fünftägigen Verzögerung bei der Veröffentlichung des Online-Tagebuchs, „bin irgendwie in der Vorzeit zuhause, aus der ich wie hinter dicken Glasscheiben winken kann, während es, kaum dass ich es niedergeschrieben habe, schon heißen kann: ‚Ha, damals, als wir noch diese Probleme hatten!‘“ Dieses eher redaktionell denn medial verursachte Problem verschiebt sich nochmals im Blick auf den Zeitindex der Maßnahmen und Prognosen, mit denen der Ausbreitung des Virus begegnet wird. Da man immer erst ein, zwei Wochen später wissen kann, was die aktuell durchgeführten Maßnahmen gebracht haben, ist im Prinzip auch die unmittelbare Gegenwart schon von dicken Glasscheiben umstellt, die verspätete Einsichten, verfrühte Aktivitäten und angemessene Aktualisierungen nicht immer als solche sichtbar machen (was aber vielen auch schon vor Corona als Kennzeichen der Gegenwart galt).
Röggla hebt noch eine weitere Form dieser Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hervor, die gegenwärtig besonders deutlich hervortritt, aber genau genommen auch schon früher zu beobachten war: „Während immer neue Nachrichten hereinbrechen in immer engmaschigerem Takt, deren Hyperaktualität seltsamerweise noch nicht einmal enervierend wirkt, verhält es sich doch oft so, als würde ich das immer Gleiche lesen.“ Die monothematische Fokussierung nahezu aller Kommunikationsmedien zeitigt ihre hypnotischen, zugleich aufregenden wie beruhigenden Effekte nicht zuletzt dadurch, dass permanent auf allen Kanälen gesendet wird, auch wenn es, wie häufig, nichts, zumindest nichts Neues zu melden gibt. Die vielen Tagebücher und die ungezählten Statusmeldungen in Sachen Corona, die viele Timelines der Sozialen Medien wie einen monothematisch fokussierten Gruppenchat erscheinen lassen, reflektieren diese Konstellation gewissermaßen in Echtzeit – und setzen sie eben dadurch im Modus der Logik des Viralen auch fort.
„Kann es sein“, fragt sich Thomas Stangl im Grazer Corona-Tagebuch, „dass all das, was uns eben noch als gegenwärtig, aktuell, dringlich erschienen ist, von nun an völlig fremd wird, weil sich einfach das Koordinatensystem geändert hat?“ Und Kathrin Röggla schreibt: „Werde ich jetzt eine Springerin zwischen den Zeiten (Gegenwart, Zukunft 1 und Zukunft 2, rasende Vergangenheit)? Zukunft ist durch die drohende Destabilisierung auf heikle Weise wieder vielfältig geworden, die breite Gegenwart beendet. Diese Schwierigkeiten werden uns noch lange begleiten. Es ist nicht abzusehen, was das heißt, dass jetzt eine neue Ära beginnt.“ Der Vorschlag, den Röggla im Nachdenken über die Rolle von Prognosen aus ihren eigenen Prognosen ableitet, ist so einfach wie komplex und bildet nicht zuletzt einen brauchbaren Gegenentwurf zu der von Paolo Giordano in seinem Corona-Tagebuch schon jetzt in Buchform vorliegenden Forderung, „der Epidemie einen Sinn zu geben“.
Röggla setzt auf das Programm einer Literatur, das möglicherweise auch deshalb angemessen und zeitgemäß wirkt, weil es für viele – auch für Röggla – nur bedingt ein grundlegend neues Koordinatensystem oder den Beginn einer neuen Ära in Aussicht stellt: „Eigentlich wären Texte ja hilfreich, die versuchen, die Lage zu erkennen, und insofern sich doch der konkreten Beschreibung des Alltags zuwenden, aber eben einer, die nicht auf etwas hinaus will, der Matrix eines Alarmismus genauso wenig wie dem Programm einer Weltrettung folgend, einer der gemischten Realitäten, die dem Nebeneinanderher von neuer Logik, alten Problemen, unerwarteten Auswirkungen der Situation gerecht wird. [...] Es wird ein Arbeiten mit verschiedenen Zeitmodi sein müssen, die Zeitebenen müssen wieder in Kontakt miteinander kommen, und so wird sich Literatur in dieser Situation mehr denn je als Zeitkunst erweisen müssen.“
Eckhard Schumacher