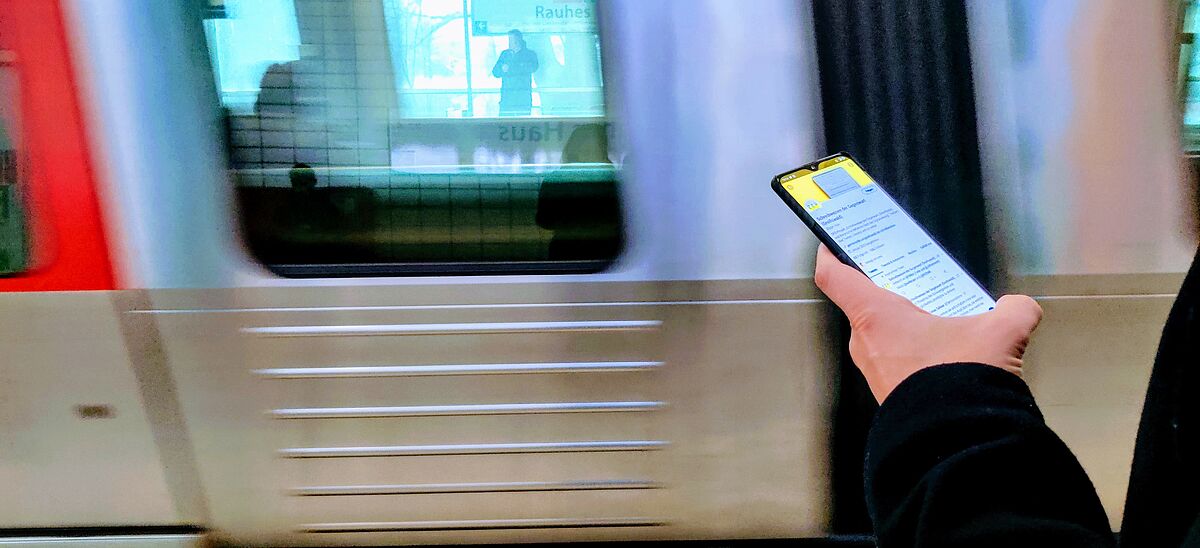Tagebücher als Krisenphänomen: Während der Corona-Pandemie tauchten vielerorts und in verschiedenen medialen Formaten Journale auf und werden zum Teil bis heute weiter fortgesetzt. Die Konjunktur des Tagebuchs wurde auch vom Feuilleton schnell als Thema aufgegriffen, wenn auch nicht unbedingt mit positiver Wertung. Julia Encke schrieb in der FAS vom 5. April von „Gedankenkitsch“ und urteilte, dass „mit diesem ganzen hohlen Pathos und der Trostprosa […] gar nichts gewonnen“ sei. Marie Schmidt verschob in der Süddeutschen Zeitung vom 16. April den Akzent ein wenig. Auch sie beschreibt zwar das „Protokoll der Krise“ als so „vielstimmig und wirr wie die Krise selbst“, stellt aber die Frage, wie denn überhaupt literarisch über sie zu schreiben sei. Beide greifen in ihren Beiträgen Fragen auf, die Kathrin Röggla schon in einem Text in der FAZ vom 21. März mit dem Titel „Prognosefieber“ thematisiert hatte: dass jene Versuche des Auf- und Mitschreibens vor allem in Hinblick auf Verschiebungen in der Zeitwahrnehmung zu perspektivieren seien. Literatur müsse sich einmal mehr als Zeitkunst beweisen. Diese Forderung steht im Kontext unzähliger Äußerungen zur Zeitwahrnehmung in der Corona-Pandemie, die im Philosophie-Magazin genauso zu finden sind wie im Tagesspiegel, in den Twitter-Timelines genauso wie in den angesprochenen Tagebüchern. Um diese geht es im Folgenden im Besonderen. Als Gegenstand der Diskussion im DFG-Forschungsprojekt dienten insbesondere das kollektive Tagebuch auf 54books, das Journal von Carolin Emcke in der Süddeutschen Zeitung sowie das mehrstimmige Tagebuch auf der Internetseite des Literaturhauses Graz unter Beteiligung von Kathrin Röggla. Dieser Text ist Teil einer Reihe, die hier im Blog in fünf Teilen erscheint und zuerst auf 54books veröffentlicht wurde.
(Wollte ja immer dabei sein, wenn „Geschichte passiert“, Kubakrise und sowas. Findet man auch nur, wenn man den Ausgang schon kennt, wird mir gerade so bewusst.)
— ellebil (@ellebil) 15. März 2020
Welchen Wert haben Tagebücher, die wissend für die Öffentlichkeit geschrieben werden? Unter einem Tagebuch versteht man zunächst die Sammlung intimster Gedanken, es ist eine Form der privaten Reflexion, es wird nicht geschrieben, um eine Wirkung auf Lesende zu haben. Besondere Formen stellen die Journale von Literat*innen dar, da diese sich der nachträglichen Veröffentlichung vielleicht schon beim Verfassen bewusst waren. Bei den Corona-Tagebüchern, die momentan überall und in jeder Form (als Video, Podcast oder Text) zu finden sind, gibt es verschiedene Ansätze. Teils schreiben (oder streamen) Privatpersonen, teils Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, wie etwa der Wirtschaft. Es sind häufig Texte von Menschen, die von Entschleunigung sprechen und diese auch persönlich im Home-Office in den eigenen vier Wänden, oft mit Balkon oder Garten, wahrnehmen. Verzerrt es nicht die Realität, wenn hauptsächlich die dokumentieren, die vom Kampf gegen die Pandemie am wenigsten spüren? Wenn sie nicht aus dem Krankenhaus, dem Supermarkt oder vom Leben auf der Straße berichten, was für eine Funktion haben die Tagebücher dann? Sie versuchen, den Ausnahmezustand festzuhalten, zu verarbeiten, zu bewerten, jedoch nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen. Wie der Hashtag #weareallinthistogether vermitteln die Tagebücher Trost und stiften Gemeinschaft. Aus ihnen ist herauszulesen, dass die Monothematik der Coronapandemie und der gesteigerte Nachrichtenkonsum mehr und mehr Menschen bedrücken. Für wen sind die öffentlichen Tagebücher dann geschrieben? Wenn das gegenwärtige Publikum nicht interessiert ist, bleibt der Blick in die Zukunft. Coronatagebücher sind Dokumente, die für die Zeit nach Corona geschrieben werden und vermutlich auch im Herbstprogramm der Verlage zahlreich vorhanden sein werden.
Auf dem Blog 54books entsteht ein kollektives Tagebuch von 29 Autor*innen, das mit dem Ziel geführt wird, Veränderungen zu dokumentieren und u.a. Tweets zu archivieren. Das gemeinsame Schreiben an einem Projekt, das die durch die Pandemie geschlossenen Landesgrenzen überwindet, führt schon während des Entstehungsprozesses zur psychischen Erleichterung bei den Autor*innen: „Ich merke, wie gut mir das Schreiben an diesem kollektiven Tagebuch tut. Manchmal, wenn ich eine Notiz hinterlassen will, sehe ich, dass andere gerade auch schreiben, und ich stelle mir vor, wie sie irgendwo auf dem europäischen Festland vor ihren Bildschirmen sitzen und tippen und korrigieren, während ich hier an meinem Schreibtisch auf der Insel genau das Gleiche mache. Eine Gemeinschaft von Schreibenden in Zeiten der sozialen Distanz“ (Marie Isabel Matthews-Schlinzig, 54books). Die unmittelbare Gegenwart im Schreibprozess kombiniert mit der Gleichzeitigkeit des Schreibens als Erfahrung gemeinsamer Gegenwart steht der verzögerten Veröffentlichung gegenüber: Die Texte sind schon veraltet, wenn sie erscheinen.
Es sind Spannungsverhältnisse, die die Zeitwahrnehmung dominieren: Hartmut Rosa spricht von einer erzwungenen Entschleunigung, die für uns körperlich und wirtschaftlich spürbar ist. Diese Lücke, die die scheinbar freie Zeit mit sich bringt, wird nach Rosa von der „mediale[n] Berichterstattung über das Fortschreiten der Epidemie in Echtzeit […| symptomatisch“ ausgefüllt. „Das soziokulturelle Leben spaltet sich gerade in ein physisch entschleunigtes ‚realweltliches‘ und ein hyperventilierendes digitales Leben.“ Auch in den Tagebüchern von 54books spiegelt sich dieser Aspekt wider. Auf der einen Seite wird die Entschleunigung des Alltags bemerkt, die sich bei einem Autor sogar auf das Lesetempo auswirkt: „Ich lese mehr, ich lese langsamer“ (Viktor Funk, 54books). Auf der anderen Seite steht ein zunehmendes Unwohlsein, das sich im Umgang mit den Sozialen Medien entwickelt: „Die Menge an Berichterstattung und digitalem Lärm steht in einem schwer aushaltbaren Missverständnis zur (scheinbaren?) Ungewissheit der Situation“ (Marie Isabel Matthews-Schlinzig, 54books). Oder: „Ich lese regelmäßig twitter und merke, dass es nicht gut tut, ich es aber auch nicht lassen kann. Jede*r postet ständig Artikel wie es jetzt weitergehen könnte. Es entstehen Diskussionen über Fake-News, die heute keine Fake-News mehr sind. Alle regen sich auf, niemand weiß genaues“ (Charlotte Jahnz, 54books). Die Stimmung ist angespannt und dominiert von der Sorge um eine ungewisse Zukunft. Marlene Kayen, die Vorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs, begründet in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung die Konjunktur des Tagebuchschreibens wie folgt: „Ich habe den Eindruck, dass sie sich einen kleinen Fluchtraum aufbauen, in den sie sich zurückziehen und ungefiltert Sachen aufschreiben. Vielleicht lassen sich deshalb an Tagebüchern so gut psychische Entwicklungen beobachten.“ In den Journalen werden nur die subjektiven Wahrnehmungen der Pandemie festgehalten, hier wird die enge Verknüpfung von persönlicher Wahrnehmung und Zeit besonders deutlich. Es ist eine gegenwärtige Fokussierung auf den Moment, ein Konservieren des Jetzt und eine Form der Beruhigung, da es für den Moment des Schreibens nur um das Jetzt geht. Die wegfallende, gewohnte Strukturierung eines Tages, verbunden mit dem Warten auf Neuigkeiten und das Ende der Pandemie, führen zu einem Schwebezustand, zu einem Leben neben der Zeit. Maike Ladage schreibt dazu auf 54books: „Immerzu verwundert. Ausnahmezustand ständig präsent, gleichzeitig seltsames Aus-der-Zeit-Fallen und ganz Gegenwärtig-sein.“ Das tägliche Schreiben liefert den Rhythmus, der dem Alltag mittlerweile fehlt, selbst die Bus- und Zugpläne folgen nun einer anderen Zeitrechnung: „Seit Mittwoch ist jetzt immer Samstag. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben eine neue Zeitrechnung für uns angefangen“ (Rike Hoppe, 54books).
Zuletzt sind Tagebücher aber auch eine Form, etwas von sich zu konservieren und zurückzulassen, weil selbst der eigene Ausgang ungewiss ist. Das Schreiben tritt somit dem Vanitas-Gedanken entgegen, der durch den Tod als definitiven Endpunkt der Lebenszeit aktuell präsenter ist: „Die Verheerungen, die das Virus anrichtet, sind unserer Fantasie überlassen. Sterbende bleiben isoliert, nicht einmal Angehörige dürfen zu ihnen. Der Weg, den letztlich jeder allein geht, ist nun ein einsamer. Ihre Gesichter sehen wir dann manchmal doch: Wenn sie uns aus italienischen Todesanzeigen entgegenblicken, noch aus dem Leben, aus ihrer Vergangenheit in unsere Gegenwart“ (Marie Isabel Matthews-Schlinzig, 54books).
Lena Pflock