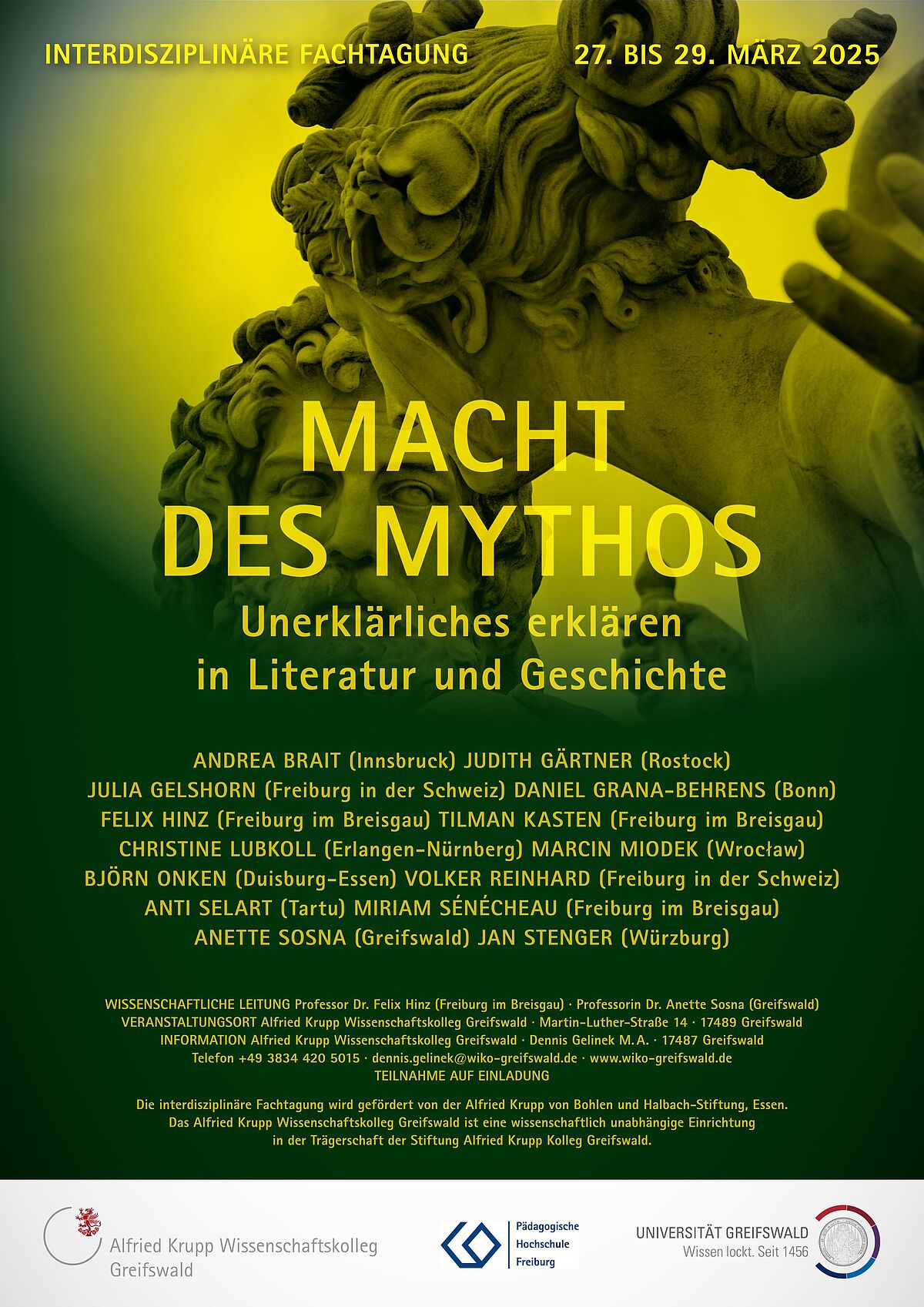Tagungen
Interdisziplinäre Fachtagung "Macht des Mythos – Unerklärliches erklären in Literatur und Geschichte"
unter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Dr. Felix Hinz (Freiburg im Breisgau) und Professorin Dr. Anette Sosna (Greifswald)
Die interdisziplinäre Fachtagung widmet sich der zentralen Frage, welche Rolle Mythen als Erklärungsansätze für das Unfassbare in Literatur, Geschichte und Bildung spielen. Mythen besitzen nicht nur historische, sondern auch gegenwärtige Bedeutung: Sie strukturieren kulturelle Vorstellungen, prägen Narrative und sind zugleich Gegenstand kritischer Reflexion in Wissenschaft und Didaktik. Das Hauptziel der Tagung besteht darin, theoretische, gesellschaftliche und didaktische Perspektiven zu Mythen interdisziplinär zu verknüpfen. Dabei werden sowohl die Funktionen und Formen von Mythen in verschiedenen Kontexten als auch ihre Relevanz für den Deutsch- und Geschichtsunterricht eingehend untersucht. Mit einem Fokus auf aktuelle Herausforderungen – von der Bedeutung medial tradierter Mythen bis hin zur Vermittlung historischer und kultureller Kompetenzen – bietet die Tagung einen Raum für innovative Diskussionen und den Austausch über disziplinäre Grenzen hinweg.
Das Programm finden Sie hier: Flyer
Veranstaltungsort: Alfried Krupp Wissenschaftkolleg Greifswald
Datum: 27.–29.03.2025
Interdisziplinäre Projekttagung
unter der wissenschaftlichen Leitung von Professorin Dr. Anette Sosna
In der gymnasialen Oberstufe spielt Literaturgeschichtsunterricht eine wichtige Rolle. Schülerinnen und Schüler lernen die Epochen der Literaturgeschichte und ihre Besonderheiten kennen, so zum Beispiel die der Klassik, Romantik oder die des Expressionismus. Um diesen Unterricht lebendig und motivierend zu gestalten und Lehrkräften zeitgemäße didaktische Impulse dafür zur Verfügung zu stellen, werden im Projekt „Romantik revisited – Literaturgeschichte im Dialog“ zusammen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, dem Deutschen Romantik-Museum in Frankfurt am Main, dem Beethoven-Haus in Bonn und dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald Konzepte für den Deutschunterricht erarbeitet, die später allen Deutschlehrkräften zur Verfügung stehen sollen.
Die Tagung dient der Präsentation, Diskussion und Multiplikation des didaktischen Konzepts und zeigt die bisherigen Ergebnisse der Kooperation zwischen Kultureinrichtungen, Schulen und Universität, sodass Lernen an und mit Kultureinrichtungen als Chance deutlich wird, Unterricht zu öffnen, Lernen fach- und altersgerecht zu gestalten und Lernengagement zu aktivieren. Die Unterrichtskonzepte unterstützen das Unterrichten von Lehrplaninhalten. Sie stellen optionales Zusatzmaterial bereit, das im Unterricht flexibel eingesetzt werden kann.
Die Präsentationstagung ist als Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte des Landes M-V anerkannt.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Arbeitstagung „Praktiken der Erinnerung – Holocaust und Nationalsozialismus im Deutschunterricht der Zukunft“
am Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald (2.-4. Mai 2024)
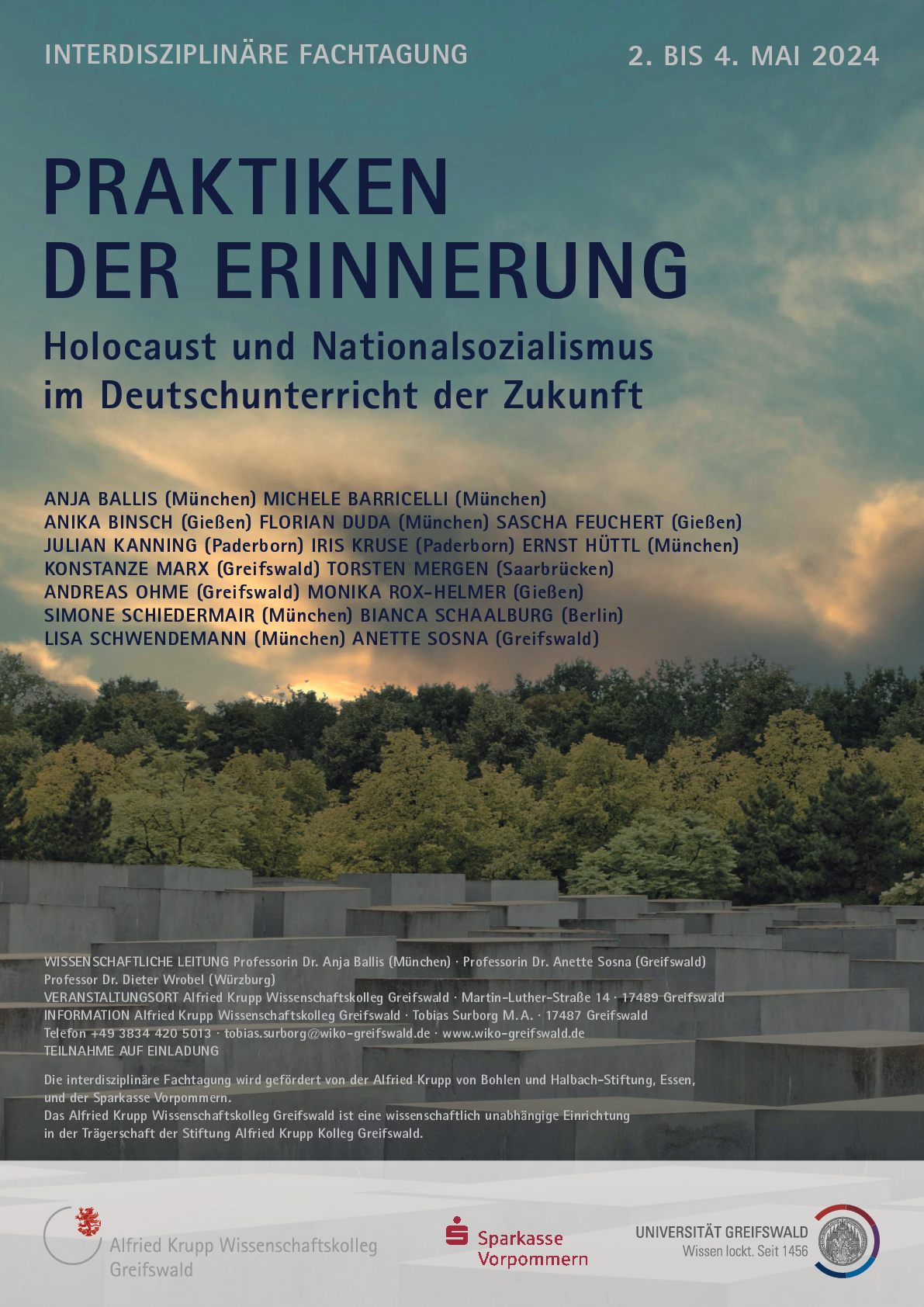
Tagungsorganisation: Anja Ballis, Anette Sosna, Dieter Wrobel
Hier finden Sie das Programm der Tagung.
Die Tagung adressiert angesichts der aktuellen chronologischen Schwellensituation der Thematik von Holocaust und Nationalsozialismus ein breites inhaltliches Spektrum. Ziel der Tagung ist, theoretische, empirische, konzeptuelle und praxeologische Perspektiven der Aktualisierung und Adaptierung von Lehr-Lern-Prozessen zu Holocaust und Nationalsozialismus im Deutschunterricht unter den Bedingungen aktueller gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse zusammenzuführen.
Die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zeigen, dass die Auseinandersetzung mit Holocaust und Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor von großer und inzwischen wieder zunehmender Bedeutung ist. Zu beobachten sind Entwicklungen wie ein kontinuierlicher Anstieg antisemitischer Straftaten und die zunehmende Verbreitung judenfeindlichen Gedankenguts im Internet, denen die Bundesregierung aktuell mit einer Nationalen Strategie gegen Antisemitismus zu begegnen versucht.
Der Schule als einer der zentralen gesellschaftlichen Sozialisationsinstanzen kommt in diesem Prozess eine besondere Bedeutung zu. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Nationalsozialismus ist hier zwar fest verankert, erscheint aber sowohl quantitativ wie auch inhaltlich in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Deutlich wird, dass Erinnern als kulturelle Praxis den Lebens- und Lernvoraussetzungen nachwachsender Generationen angepasst und auch der Erinnerungsbegriff selbst aktualisiert und reformuliert werden muss. Die Tagung will sich diesem Wandel und den daraus resultierenden neuen Herausforderungen aus unterschiedlichen fachdidaktischen, aber auch inter- und transdisziplinären Perspektiven widmen und das Leitfach Deutsch in diesem spezifischen Themenbereich neu vermessen.